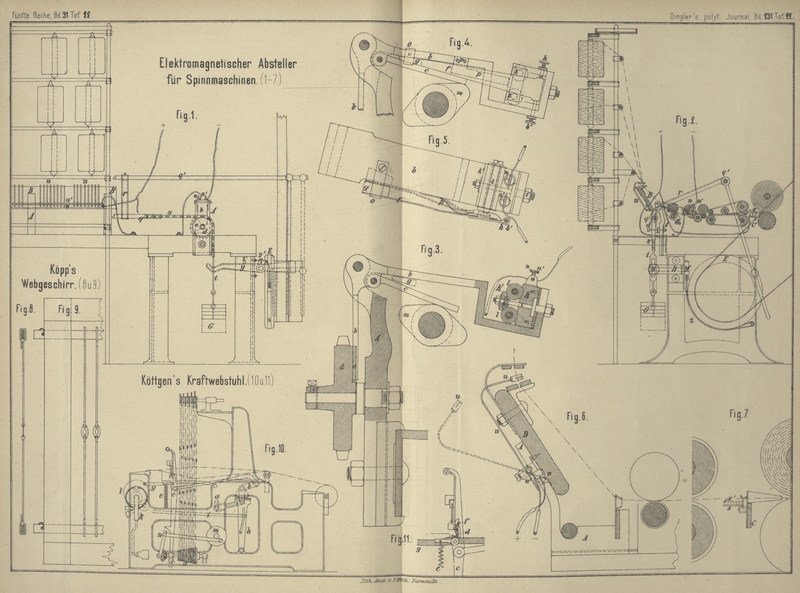| Titel: | Elektromagnetischer Absteller für Spinnmaschinen. |
| Autor: | E–e. |
| Fundstelle: | Band 231, Jahrgang 1879, S. 231 |
| Download: | XML |
Elektromagnetischer Absteller für
Spinnmaschinen.
Mit Abbildungen auf Tafel 22.
Elektromagnetischer Absteller für Spinnmaschinen.
Der für die Augsburger Kammgarnspinnerei in
Augsburg (*D. R. P. Nr. 1982 vom 23. October 1877)
patentirte, auf Taf. 22 näher veranschaulichte Absteller soll (namentlich bei den
sogen. Bobinoirs) beim Brechen oder Fehlen eines der zu doublirenden Fäden, oder
aber beim Wickeln um die Cylinder die Maschine sofort selbstthätig aufhalten (vgl. *
1878 230 198).
Die über die Kettenrolle d (Fig. 1 und
2) gelegte Kette s trägt an dem einen Ende
mittels eines mit einem langen Schlitze versehenen Hakens t ein Gewicht G (4 bis 5k) und ist mit ihrem anderen Ende an der Stange
q befestigt, welche längs der Maschine hinläuft und
durch einen Hebel r mit der ebenfalls längs der
Maschine hinlaufenden und rechts die über den Riemenscheiben befindliche, zum
Anlassen und Abstellen der Maschine dienende Gabel tragenden Stange q' verbunden ist. Wird nun die Maschine mittels der
Stange q' in Gang gesetzt, so zieht die Stange q mittels der Kette s das
Gewicht G auf, und es legt sich dabei, durch das
Uebergewicht seines wagrechten Armes, der senkrechte Arm des Winkelhebels b hinter dem an ihm eben vorbeigegangenen Segmente e der Rolle d dicht an
diese Rolle an und verhindert so, daſs sich das aufgezogene Gewicht wieder senkt.
Auf dem Supporte D ist ferner ein zweiarmiger Hebel y gelagert; der eine Arm desselben greift mit einem
Schnabel in den Schlitz des Hakens t hinein; auf seinen
andern Arm wirkt ein Gegengewicht und legt den ersteren Arm für gewöhnlich an den
Zapfen z' an; auf der Achse dieses Hebels sitzt aber
noch ein Segment y', woran mittels eines Stahlbandes
die Bremse z befestigt ist. Im Zustande der Ruhe steht
die Bremse sehr nahe an dem Schwungrade E der Maschine,
und ein auf dem Speisecylinder befestigter Doppeldaumen m (Fig. 2 bis
5) bewegt bei jedem Umlaufe eine an dem Hebel b befindliche Zunge c zweimal auf und
nieder.
In dem wagrechten Arme des Hebels b ist der
Elektromagnet ll zwischen den Holzlagern k, k' mittels einer Metallplatte und des Bolzens i befestigt. Seine beiden Kerne sind in eine
Metallplatte eingeschraubt und zwei in dieser sitzende Stellschrauben h, h' tragen zwischen ihren Spitzen den Ankerhebel f des Elektromagnetes; eine schwache Feder p drückt den Ankerhebel in der Ruhe gegen den
Metallwinkel o; zieht aber der Elektromagnet seinen aus
einer weichen Eisenplatte bestehenden Anker an, so legt sich der am Ende des
Ankerhebels befindliche Stahlkeil g zwischen die Zunge
c und den wagrechten Arm von b, und dann hebt der nächstfolgende Daumen von m nicht mehr die Zunge allein, sondern auch den
wagrechten Arm von b empor und entfernt so zugleich dessen
senkrechten Arm von der Rolle d; letzterer läſst daher
jetzt das Segment e frei, das Gewicht G senkt sich und legt so mittels der Stangen q und q' den Treibriemen
auf die Leerscheibe der Maschine. Bevor ferner G das
Ende seines Laufes erreicht (etwa 20mm vorher),
erfaſst der Schlitzhaken t den Schnabel des zweiarmigen
Hebels y, nimmt ihn mit und preſst dadurch die Bremse
z gegen das Schwungrad E.
Die Stromschlieſsung, welche den Elektromagnet seinen Anker anziehen läſst,
vermittelt entweder einer der Fadenwächter u (Fig.
2 und 6) beim
Eingange der Doublirungsfäden, oder einer der Fadenwächter x (Fig. 2 und
7) beim Ausgange des doublirten Fadens vor der Aufspulung desselben. Die
messingenen Fadenwächter u drehen sich mit Leichtigkeit
um eine Metallstange u'; diese Metallstangen u' sind mittels kleiner Metallträger auf einem Brete
B befestigt und in ihrer Mitte durch Holzträger
unterstützt; durch isolirte Kupferdrähte stehen sie unter sich und mit dem Gestelle
in leitender Verbindung; vom Gestell aus aber führt ein isolirter Draht durch den
Elektromagnet zum negativen Pole der Batterie; vom positiven Pole dagegen geht ein
Draht zu einem in das Bret B eingelegten Metallbande
v. Durch das Auge am oberen Ende jedes
Fadenwächters u geht ein von einer Spule kommender
Faden; bricht derselbe, so fällt u durch sein
Uebergewicht rückwärts nieder und trifft schlieſslich mit seinem Schwänze auf das
Band v; der Strom ist dadurch geschlossen, und der
Elektromagnet bringt die Maschine augenblicklich zum Stillstande.
Die messingenen Fadenwächter x sitzen an einer vor den
Aufspulwalzen der Vorbereitungsmaschine über die ganze Länge der Maschine laufenden
Eisenschiene C, jeder bei einem Trichter und mit seinem
längeren Arme auf dem in den Trichter eintretenden Faden ruhend. Bricht dieser
Faden, so fällt das längere Ende von x nieder und sein
sich hebendes kürzeres Ende legt sich an einen in Porzellankapseln isolirten
Messingdraht x' an, welcher ebenfalls mit dem positiven
Batteriepole verbunden ist. Jeder Fadenbruch schlieſst also ebenfalls den Strom
durch den Elektromagnet und stellt die Maschine ab.
E–e.
Tafeln