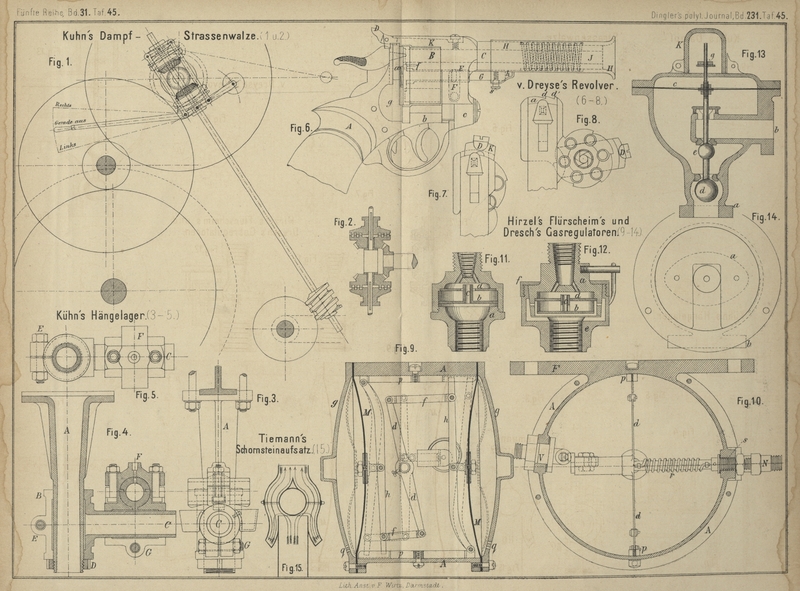| Titel: | Die Stuttgarter Dampf-Strassenwalze; gebaut von G. Kuhn in Stuttgart-Berg. |
| Fundstelle: | Band 231, Jahrgang 1879, S. 505 |
| Download: | XML |
Die Stuttgarter Dampf-Straſsenwalze; gebaut von
G. Kuhn in
Stuttgart-Berg.
Mit Abbildungen auf Tafel 45.
Kuhn's Dampf-Straſsenwalze.
Die ersten Versuche, die Straſsenwalzen mit Dampfkraft zu betreiben und so den
mühsamen Pferdezug zu beseitigen, wurden Mitte der 60er Jahre in Frankreich und
England gemacht, und wären die ausgezeichneten Resultate, welche dabei erzielt
wurden, hinlänglich bekannt geworden, so müſste die Anwendung dieser Maschinen
bereits eine allgemeinere sein; in Deutschland sind sie so zu sagen noch unbekannt,
denn auſser Berlin, Königsberg und seit neuester Zeit StuttgartIn Oesterreich Wien, in Ungarn Pest und in der Schweiz Winterthur.
besitzt keine deutsche Stadt eine solche Maschine.
Würde man der Dampfstraſsenwalze bisher mehr Interesse gewidmet haben, so könnte man
sich jetzt sicher nicht mehr mit dem Gedanken tragen, die sogen.
„Macadamstraſsen“ zu verlassen und auf kostspielige Pflasterung
überzugehen; denn alle die Unzuträglichkeiten, wie Gefährlichkeit, Schmutz und
Staub, welche man den ersteren nachsagt, werden bei Anwendung der Dampfwalze in
einem Grade gemindert, daſs sie stichhaltig nicht mehr geltend gemacht werden
können. Keinesfalls hätte das zur Sommerszeit seines durchdringenden Geruches wegen
so unangenehme, bei Regen und Glatteis so gefährlich passirbare Asphaltpflaster,
sowie das durch seine Absorptionsfähigkeit so gesundheitsschädliche Holzpflaster
Verbreitung gefunden.
Bei der Herstellung eines guten, dauerhaften Straſsenkörpers kommt es hauptsächlich
darauf an, daſs die Geschlägsteine dicht an einander in den Straſsenkörper
eingepreſst werden, ohne hierbei ihre scharfkantige Form einzubüſsen; dies zu
bewirken, ist jedoch nur eine schwere Walze, welche einige Male über den Einwurf zu
gehen hat, im Stande, nie aber eine leichte, von Pferden gezogene Walze, die zur
einigermaſsen genügenden Einbettung der Schottersteine ungleich öfter den
Straſsenkörper befahren muſs; denn eben durch dieses häufigere Darüberfahren, mahlen
sich die Steine an ihren scharfen Kanten derart ab, daſs sie einen festen Straſsenkörper niemals dauernd zu geben
vermögen. Ueberdies wühlen die Walzenzugpferde den nothdürftig fest gewalzten
Schotter mit ihren Hufen immer und immer wieder auf.
Das mühsame Umwenden der Pferdewalzen (wobei sie anderen Fuhrwerken ein lästiges
Verkehrshinderniſs bilden), das ungleiche Ziehen der Pferde und die Schwierigkeit
der Führung eines gröſseren als Sechser- oder Achterzuges haben zur Folge, daſs sie
eben kaum die halbe Zeit arbeiten, dabei aber zudem eine Arbeit leisten, wie sie für
die stark befahrenen Macadamstraſsen gröſserer Städte keineswegs genügt, welche
somit in keinem Verhältniſs zu den aufgewendeten Kosten steht.
Soll nun eine Straſse eingewalzt werden, so ist Bedingung, daſs dieselbe entweder
durch vorausgegangene nasse Witterung oder durch Besprengen mit Wasser durchfeuchtet
und dadurch einigermaſsen weich gemacht wird, damit die Steine durch die schwere
Walze nicht zermalmt, sondern fest und zwar mit ihrer flachen Seite nach oben,
eingedrückt werden. Die etwaigen Zwischenräume werden durch wiederholtes Bestreuen
mit Sand und Begieſsen mit Wasser ausgefüllt, sowie mit der Walze vollends wie zu
einem Guſse festgewalzt; hierauf wird die Straſse durch reichliches Besprengen mit
Wasser reingewaschen.
Nach den Angaben der Pariser Ingenieure, welchen langjährige Aufzeichnungen zu Grunde
liegen, gewähren Straſsen, die mit Dampfkraft eingewalzt wurden, gegenüber solchen,
auf denen Pferdewalzen thätig waren, eine Ersparniſs an Herstellungskosten von rund
50 Proc.; auſserdemanſserdem werden erstere Straſsen mit der Zeit so fest, daſs wenn sie sonst jährlich
zweimal eingewalzt werden muſsten, sie jetzt nur noch einmal des Jahres den Dienst
der Dampfwalze beanspruchen; auch leisten bei stark befahrenen Straſsen die schwersten Walzen die besten Dienste. Dies waren nun
auch die Gründe, welche den Stuttgarter Gemeinderath, der jährlich bedeutende Summen für
Unterhaltung der vielen neuen Straſsen zu bewilligen hatte, ohne dabei den
gewünschten guten Zustand derselben zu erzielen, veranlaſsten, zum Einwalzen der
Straſsen mittels Dampfkraft überzugehen.Die Winterthurer Maschine wurde von einer städtisch-technischen Commission
eingesehen und hierauf von den in engerer Concurrenz in- und ausländischer
Fabrikanten eingeforderten Eingaben demjenigen von G. Kuhn in Stuttgart-Berg im Mai 1878 der Zuschlag
ertheilt.
Die Maschine sollte programmmäſsig mindestens 15000k Leergewicht und eine gröſste Breite von 2m erhalten; auch war als Grundtypus die bewährte Anordnung der Aveling und Porter'schen Maschinen vorgeschrieben. Die
Maschine muſste demnach hinten zwei groſse Triebräder von etwa 1500mm Durchmesser und vorn zwei kleinere conische
Leiträder erhalten; 1000l Speisewasser waren in
seitlichen Wasserkästen mitzuführen, desgleichen in besonderem Behälter 200k Kokes. Die kgl. Staatsregierung bestimmte einen
sicher und rasch wirkenden Lenkapparat und eine kräftige Bremsvorrichtung; auch
sollten sämmtliche in lebhafter Bewegung befindliche Theile durch Blechmäntel dem
Anblick der Maschine begegnenden Zugthiere entzogen sein. Da zur sichern Bedienung
namentlich bei Fahrten durch belebte Stadttheile zwei Mann als nöthig erkannt
wurden, war auf einen geräumigen Führerstand Bedacht zu nehmen, welch letzterer, da
die Maschine meist bei nasser Witterung in Dienst tritt, bedeckt vorgesehen
wurde.
Nachdem in Stuttgart in neuerer Zeit das äuſserst harte Porphyrgeschläg zur Anwendung
kommt, und da ferner Straſsen bis zu 8 Proc. Steigung eingewalzt werden müssen, so
war eine besonders kräftige Maschine mit einem reichlichen Kessel bedingt. Die
Maschine kann bis zu 35e ausüben, die Heizfläche
des Kessels beträgt 21qm,5 bei 8at Ueberdruck; die Construction ist die des
gewöhnlichen Locomotivkessels mit viereckiger kupferner Feuerbüchse und 74
Messing-Siederöhren von 45mm Lichtweite. Der
schmiedeiserne Rost ist zum Zwecke bequemer Reinigung um eine horizontale Achse
drehbar; der Aschenkasten ist, wenn nöthig, allseitig dicht schlieſsbar; auch
verhindert ein in der Rauchkammer schräg vor die Rohre gestelltes Metallsieb das
Auswerfen glühender Kokestheile.
Die auf dem Kessel angebrachte Maschine ist eincylindrig, was beim Anfahren bei
einiger Uebung des Maschinisten durchaus keine Schwierigkeiten bietet, da ein
schweres Schwungrad die todten Punkte überwindet. Der Cylinder ist in den Dampfdom
eingebaut und wird die Kraft von hier aus mittels Kurbelmechanismus und
Räderübersetzung auf die 1700mm groſsen, 500mm breiten Treibwalzen übertragen. Die
Uebersetzungsräder sind aus Stahlguſs, die Wellen aus Guſsstahl, die Treib- und
Leitwalzen aus Hartguſs (besonderer Satz in eisernen Formen gegossen). Die Achse der
conischen Leiträder ist innerhalb Grenzen universal drehbar. Die Veränderung ihrer
Richtung in horizontalem Sinne wird durch zwei an den Enden befestigten Ketten
bewerkstelligt, welche sich auf einer Kettentrommelwelle mittels Schneckenrad und
Schnecke rechts- und linksgängig auf- und abwickeln lassen.
Bei allen bis jetzt ausgeführten derartigen Maschinen muſs der Führer unter namhaftem
Kraft- und Zeitaufwand die Drehung dieser Trommelwelle oder des diesen Mechanismus
ersetzenden Apparates mittels Handrad vornehmen, was zur Folge hat, daſs weder
anderen Fuhrwerken rechtzeitig ausgewichen, noch enge Straſsen mit scharfen
Biegungen mit Sicherheit befahren werden können. Bei der Kuhn'schen Maschine jedoch genügt ein einziger Hebeldruck des Führers, den
Lenkapparat in oder auſser Thätigkeit zu setzen und dadurch die Maschine ohne
Verminderung ihrer Geschwindigkeit nach rechts oder links, oder im kleinsten Kreise
zu drehen. Dies geschieht einfach durch ein Schneckengetriebe (Fig. 1 Taf.
45), auf dessen Welle zwei Kegelräder lose sitzen, die mit einem dritten Kegelrade
auf der Schwungradwelle in stetem Eingriff sind. Durch eine Klemmkupplung (Fig.
2) kann entweder das eine oder das andere getriebene Kegelrad mit der
Sckneckenwelle fest verbunden und dadurch die das Vordergestell dirigirende
Kettentrommel rechts oder links gedreht werden.
Erst jetzt kann man behaupten, daſs Straſsenlokomotiven, wenn sie mit der Kuhn'schen Drehvorrichtung ausgerüstet sind, sich auch
auf Straſsen ohne Gefahr für sich selbst, für Gebäude und den übrigen Verkehr
bewegen können. Vielleicht dürfte gerade diese nun erreichte Eigenschaft für die
Einführung dieser Maschine in Deutschland bahnbrechend sein.
Als fernere Constructionsbedingung galt die möglichste Beseitigung des stoſsweisen
Austretens des Abdampfes und des damit verbundenen Geräusches. Zu diesem Zweck muſs
der Dampf ein in den beiden Wasserkasten befindliches Schlangenrohr durchstreichen,
worin er gröſstentheils condensirt und der Rest thatsächlich fast geräuschlos und
kaum sichtbar aus dem Kamin entweicht.
Für obige Bedingungen genügen die Gröſsen und Zugverhältnisse des Kessels bei Fahrten
auf Straſsen bis zu 5 Proc. Steigung. Auf gröſseren Steigungen hat Zugverstärkung
einzutreten. Diese wird durch eine Klappenvorrichtung erreicht, welche den Abdampf
mit Umgehung des Schlangenrohres direct durch das Blasrohr in den Kamin austreten
läſst.
Die Maschine war am 4. November 1878 in der Fabrik betriebsfähig hergestellt und am
23. November von der Stadtgemeinde Stuttgart in Dienst genommen. Im Laufe der
folgenden Tage wurde die Maschine in verschiedenen Stadttheilen, auf verschiedenen
Straſsen und auf verschiedenen Steigungen eingehenden Proben unterworfen. Am 2. December 1878 fand in
der frisch eingeworfenen 800m langen
Hohenheimerstraſse, welche 7¾ Proc. Steigung hat, Besichtigung durch die
städtisch-technische Commission statt, welche in ihrem hierüber abgegebenen
Gutachten sich schlieſslich dahin aussprach: „daſs die Maschine sowohl ihrer
Construction und Leistung, als auch ihrer Ausführung nach zur Uebernahme
empfohlen werden müsse.“
Die Maschine erhielt ein Gewicht von 23000k und
eine Breite von 2m,200. Die Fahrgeschwindigkeit
beträgt auf frisch eingeworfenen Straften 2 bis 2km,5, auf fertigen Straſsen 3 bis 4km in
der Stunde. Bei Anwendung von Porphyrgeschläg, und wenn etwa 10 bis 15cm hoch eingeworfen wird, ist ein 16 bis 18maliges
Befahren der Straſsenbreite nöthig bis zum Fertigwalzen; für Kalkgeschläg genügen
schon 9 bis 10 Fahrten. Die Maschine leistet somit stündlich, je nach dem zur
Verwendung kommenden Einwurfmaterial und der Höhe der Beschotterung, 250 bis 500qm fertig gewalzte Straſsenfläche; dabei
verbraucht sie 40k Kokes und 0k,15 Schmiermaterial.
Tafeln