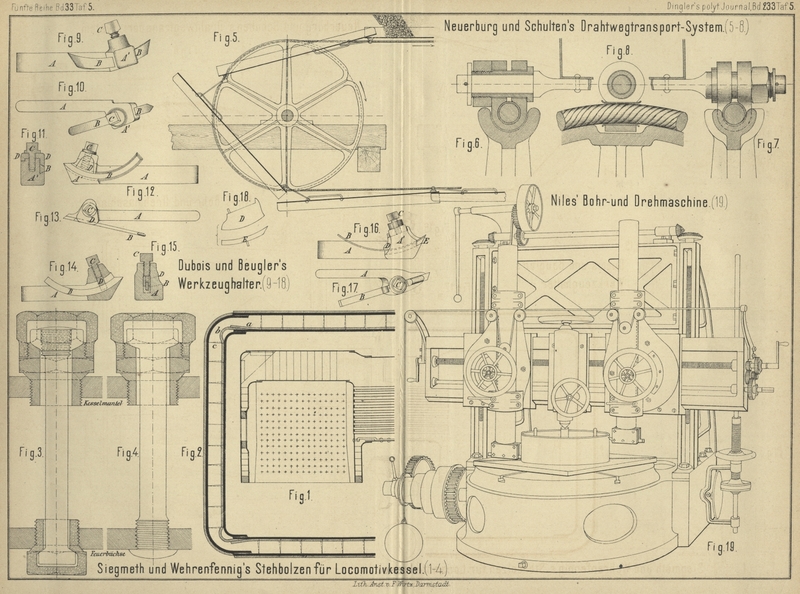| Titel: | Bewegliche Stehbolzen für Locomotivkessel, System E. Siegmeth und E. Wehrenfennig. |
| Autor: | Wilman |
| Fundstelle: | Band 233, Jahrgang 1879, S. 26 |
| Download: | XML |
Bewegliche Stehbolzen für Locomotivkessel, System
E. Siegmeth und
E.
Wehrenfennig.
Mit Abbildungen auf Tafel 5.
Siegmeth u. Wehrenfennig's bewegliche Stehbolzen für
Locomotivkessel.
Die ungleichmäſsige Ausdehnung verschiedener mit einander verbundener Kesselpartien,
dieser den Todeskeim so vieler Kesselsysteme in sich bergende Uebelstand, macht sich
nirgends zerstörender geltend als bei den Feuerbüchsen unserer Locomotiven. Aber so
sehr entspricht diese Construction im übrigen allen Anforderungen der
Locomotivmaschine, daſs sie dessen ungeachtet fast unverändert in ihrer
ursprünglichen Gestalt erhalten blieb und bis jetzt allen radicalen
Aenderungsversuchen trotzen konnte. Es gewinnt daher jedes Mittel, welches den
schädlichen Einfluſs ungleicher Wärmeausdehnung zu vermindern gestattet, erhöhte
Bedeutung und so empfiehlt sich die neue Stehbolzen-Construction der Ingenieure Siegmeth und Wehrenfennig
(Oesterreichische Nordwestbahn in Wien) noch specieller dem allgemeinen
Interesse.
Der Construction dieser Stehbolzen ging ein gründliches Studium des Wesens der in den
Locomotivkesseln zerstörend wirkenden Kräfte voraus, und so möge auch uns gestattet
sein, die Resultate jahrelanger Erfahrungen und Versuche der Erfinder
zusammenfassend, zunächst eine kurze Darlegung der durch die neue Construction zu
bekämpfenden Uebelstände zu geben.
Es folgt aus der principiellen Anordnung des Locomotivkessels, daſs die Feuerbüchse,
welche den Rost aufnimmt und die Verbrennungskammer der Locomotive bildet, von allen
Kesseltheilen die höchste Temperatur annimmt. Ihr zunächst kommen die von der
Feuerbüchsen-Rohrwand ausgehenden Siederohre, dann die Rauchkammer, während die
Bleche des Rundkessels und des Büchsenmantels die niedrigste Temperatur bewahren.
Ungleiche Temperaturen bedingen ungleiche Materialdehnungen; diese aber können sich,
bei der festen Verbindung aller Theile, nicht anders
als durch Deformationen geltend machen. Von deren Gröſse gibt die Thatsache, daſs
sich der äuſsere Kesselmantel bei etwa 6m Länge
beim Anheizen jedesmal um 8 bis 10mm verlängert,
ein drastisches Bild, denn selbstverständlich erfahren die inneren Kesseltheile, bei
mindestens doppelt so hoher Temperatur, auch eine doppelte Längendehnung, deren
Differenz gegenüber der Streckung des äuſseren Kessels sich ausschlieſslich durch
Deformationen gellend machen muſs. Dieselben vertheilen sich auf Siederohre und
Feuerbüchse und drücken sich bei den ersteren, zunächst durch Krummbiegen der langen
Rohre, aber auch durch Verschieben ihrer in den Rohrwänden befestigten Enden, sowie
durch Einwärtsbauchen der Rohrwände selbst aus; bei der kupfernen Feuerbüchse
dagegen tritt die eigenthümliche Deformation auf, welche in Fig. 2 Taf.
5 dargestellt ist.
Hier können die Wandbleche, da sie unten durch den Mantelring und in ihrer ganzen
Fläche durch Stehbolzen fix mit dem äuſseren Kesselmantel verbunden sind (Fig.
1), ihre Längenvermehrungen unmöglich in localen Ausbauchungen vertheilen,
sondern sie schieben sich, die Stehbolzen mehr und mehr abbiegend, von einer idealen
Mittellinie ausgehend, nach auswärts und ebenso nach aufwärts, bis sich endlich in
den Ecken die sämmtlichen Längenvermehrungen concentriren. Dadurch entstehen dann
hier die eigenthümlichen, in Fig. 2 grell
gezeichneten Schleifenbildungen, welche das ganze Zerstörungswerk der
Deformationsarbeit klarstellen. Die Stemmkante der durch die Nietnaht versteiften
Vorder- und Hinterwand klemmt sich, der Schleifenbildung möglichst folgend, in die
Stemmfuge der Büchsenseitenwand ein und so entstehen bei a (Fig. 2) die
„Stemmfugenrisse“; im Buge selbst wird durch das unaufhörliche Wechseln
der Schleife das Material zerstört und es bilden sich die sogen. „Bugrisse“
(b
Fig.
2); im äuſseren Bleche endlich findet aus gleichen Ursachen in Verbindung
mit dem Abwürgen der ganzen verticalen Stehbolzenreihe gleichfalls eine
Zerbröckelung des Materials statt (c
Fig.
2), welche sich übrigens bei den Eisenblechen des Mantels seltener in
Rissen als in Corrosionsfurchen geltend macht. Daſs schlieſslich die Stehbolzen
abbrechen, und zwar zunächst bei den Bügen, ist eine weitere Folge.
Alle diese Erscheinungen entspringen so naturgemäſs der ganzen Construction des
Locomotivkessels, daſs sie zu vermeiden absolut
unmöglich ist; unser Streben kann daher nur darauf gerichtet sein, sie möglichst zu
vermindern.
Dies geschieht bei neueren Ausführungen dadurch, daſs die Eckbüge möglichst groſs
gemacht und die äuſsersten Stehbolzenreihen so weit von denselben entfernt werden,
als es aus Festigkeitsgründen überhaupt noch möglich ist; doch bedingt dies
einerseits bei den Rohrwänden eine empfindliche Einbuſse in der Zahl der
unterzubringenden Rohre, andererseits insofern eine gewisse Gefahr, als die
ungünstig beanspruchten äuſsersten Stehbolzen früher oder später doch brechen müssen
und dann eine zu groſse Fläche unversteift lassen, so daſs bei nicht rechtzeitiger
Abhilfe eine Explosion erfolgen kann.
Daher muſs eine Construction, welche die Deformationsarbeit auf eine gröſsere Fläche
zu vertheilen gestattet, ohne dieselbe deshalb unversteift zu lassen, als die
einzige richtige Lösung erscheinen, und als solche betrachten wir thatsächlich das neue
Stehbolzensystem von Siegmeth und Wehrenfennig. Hier behält der Stehbolzen, wie ihn Fig.
3 Taf. 5 darstellt, vollständig den Charakter einer das Ausbauchen der
Bleche verhindernden Zugstange und gestattet dennoch die seitliche Verschiebung des
Kupferboxbleches gegenüber dem Mantelbleche, sowie ein Näherrücken des Kupferbleches
an das Mantelblech, wie dies nach Fig. 2
thatsächlich zur Schleifenbildung erforderlich wird. Der Stehbolzen, welcher von
jeder seitlichen Beanspruchung frei und ausschlieſslich auf Zug beansprucht ist,
kann entsprechend leichter gehalten werden und verspricht unbegrenzte Dauer, während
die Deformationen der Büchsenbleche allerdings nicht aufgehoben, aber ganz
wesentlich vermindert werden. Indem nämlich die jedem Buge beiderseits zunächst
liegende Stehbolzenreihe, sowie rationeller Weise auch der äuſserste Kranz der
Deckenschrauben nach dem neuen System hergestellt wird, so vermehrt sich die der
Deformationsarbeit zugängliche, zur Schleifenbildung zugezogene Blechlänge auf das
drei- und mehrfache ihres früheren Werthes und verlangsamt sich entsprechend die
zerstörende Wirkung dieser Vorgänge. Die übrigen Stehbolzen und Deckenschrauben
werden in der bisherigen Weise fest eingezogen.
Ueber die in Fig. 3
dargestellte Construction ist noch zu bemerken, daſs der selbstverständlich aus
Eisen oder Stahl hergestellte Stehbolzen am einen Ende ein Gewinde angeschnitten, am
anderen einen viereckigen Kopf angeschmiedet erhält, um welchen, nachdem er mit
einer Lehmschicht umgeben ist, eine Metallhülse gegossen wird. Mit dieser wird er
von der Feuerbüchsenseite eingeschraubt und von der Mantelseite mittels einer
sphärisch abgedrehten Mutter gegen den entsprechenden Sitz eines Futters angezogen,
welches aus Metall oder Eisen hergestellt und in das Mantelblech eingeschraubt ist.
Eine darüber geschraubte Kappe dient zum Abdichten und gestattet jederzeit rasche
Untersuchung des Stehbolzens.
Fig.
4 stellt eine wesentliche Vereinfachung dar, welche noch immer genügende
Beweglichkeit gibt und sich bei praktischen Ausführungen bestens bewährt hat.
Auſserdem läſst sich die Anordnung der Hülsen noch in der verschiedensten Weise
abändern, wie dies durch specielle Umstände erfordert wird und in den Patenten der
Erfinder (vgl. *D. R. P. Nr. 5551 vom 27. November 1878) vorgesehen ist.
Seit Ende des vorigen Jahres sind bereits 15 Locomotivkessel verschiedener
Eisenbahnen mit je 40 bis 70 Stück dieser Stehbolzen versehen worden und haben
äuſserst günstige Resultate gezeigt, indem selbst früher entstandene Risse nunmehr
in ihrem Fortschreiten gehindert wurden und nach 5monatlichem Betrieb mit den neuen
Stehbolzen völlig unverändert geblieben waren. Die Kosten der ganzen Umänderung
betragen dabei für je eine Locomotive 250 bis 300 M.
Wilman.
Tafeln