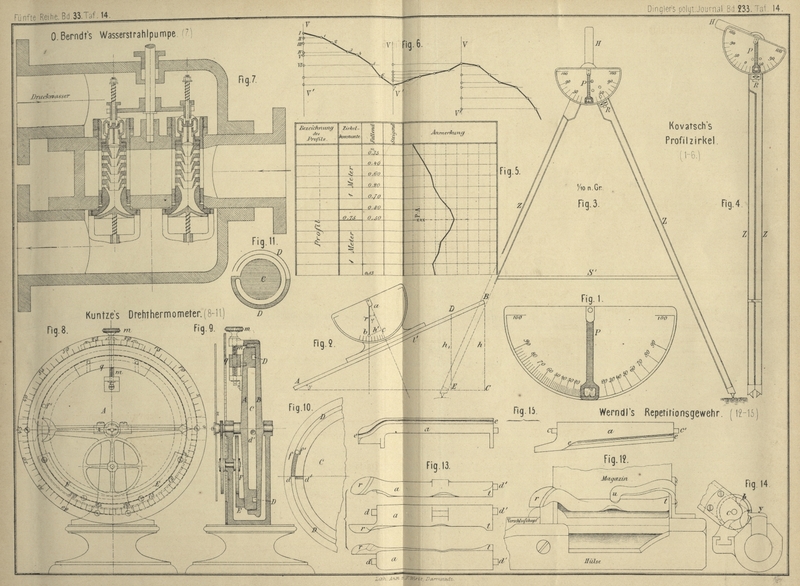| Titel: | Der Profilzirkel von Martin Kovatsch. |
| Autor: | Martin Kovatsch |
| Fundstelle: | Band 233, Jahrgang 1879, S. 118 |
| Download: | XML |
Der Profilzirkel von Martin Kovatsch.
Diplomirter Ingenieur und honorirter Docent an der
k. k. technischen Hochschule in Brünn.
Mit Abbildungen auf Tafel 14.
Kovatsch's Profilzirkel.
Theilt man einen Quadranten derart ein, daſs die Lage der Theilstriche der Reihe nach
um die Winkel:
φ
1
=
arc sin 0,01
....
..
...................
φ
2
=
arc sin 0,02
φ
99
=
arc sin 0,99
φ
3
=
arc sin 0,03
φ
100
=
arc sin 1,00
vom Nullpunkte abstehen, so erhält man (den Nullpunkt
eingerechnet) 101 ungleiche, vom Nullpunkte aus stets gröſser werdende Theile.
Wählt man die zugehörige Bezifferung so, daſs an diesen Theilstrichen der Reihe nach
die Werthe 0, 1, 2, 3, .... 99, 100 abgelesen werden können, so erhält man eine
Sinustheilung für den Radius = 100.
Eine Alhidade, welche mit einem Index versehen ist, würde vom Nullpunkte aus, um
einen beliebigen Winkel – kleiner als 90° – verdreht, die directe Ablesung der Sinus
dieser Winkel ermöglichen.Ein an derselben Alhidade angebrachter, um 90° abstehender Index würde die
directe Cosinusablösung gestatten. Zwischen je zwei Theilstrichen
könnten selbstverständlich noch Unterabtheilungen im gleichen Sinne angebracht
werden; sie wären jedoch für den vorliegenden Zweck und bei dem hierfür nöthigen
Genauigkeitsgrad überflüssig.
Der vertical gestellte Limbus des vorliegenden Instrumentes hat dies Sinustheilung
von einem mittleren Nullpunkt aus zweimal, einmal nach rechts, einmal nach links,
auf einem Halbkreise aufgetragen, der mit einem Pendelzeiger P
versehen einem Gradbogen zur Bestimmung von Höhenwinkeln ähnlich wird, wie Fig.
1 näher zeigt.
Ein solcher mit einer Sinustheilung versehener Halbkreis an eine Latte von gewisser
Länge, hier 100cm, derart befestigt, daſs bei
horizontaler Lage der Latte der Pendelzeiger auf Null steht, gibt, da Δ ABC ~ Δ abc und die dem
Winkel φ gegenüber liegenden Dreieck-weiten
proportional sind, schon eine Vorrichtung zum Profiliren (vgl. Fig. 2).
Wenn die Linie AB = 100cm = Lattenlänge, BC = der relative
Höhenunterschied der Punkte A und B, so ist:
BC=AB\ sin\ \varphi . . . . . . . . . .
(1)
und diese Zahl eben ist es, welche in diesem Falle an dem
Bogen als Sinus für den Radius = 100 abgelesen wird. Sobald der Radius 100cm beträgt, so bedeutet die abgelesene Zahl (das
Mass BC) ebenfalls Centimeter, nachdem sich die
Ablesung nach der Masseinheit jener Lattenlänge richten wird, welche der Theilung
und Bezifferung des Limbus zu Grunde gelegt wurde.
Weit handsamer und bequemer als die eben besprochene Latte ist ein groſser Zirkel mit
der unveränderlichen Zirkelöffnung von 100cm.Es stünde natürlich nichts im Wege, eine gröſsere Zirkelöffnung anzuwenden,
oder den Zirkel so einzurichten, daſs die Zirkelschenkel auf einen
Bruchtheil jener Oeffnung, welche der Theilung des Limbus zu Grunde liegt,
eingestellt werden könnte. Um für diesen Fall die richtige Ablesung zu
erhalten, wäre der Werth der Ablesung am Pendelzeiger proportional zu
vergröſsern oder zu verkleinern, oder es müſste bei Benutzung der an dem
Limbus bereits vorhandenen Theilung an die gemachte Ablesung eine der neuen
Zirkelconstanten entsprechende Correction angebracht werden.Es sei nach Fig.
2
AB=l, AD=l', BC=h,
DE=h_1, bc=h',
ab=r, so ist:h=\frac{l}{r}\,h',weil
\triangle\,ABC\sim\triangle\,abc;
\frac{l}{r}=c ist für die Theilung des Limbus
constant, somit:h=ch'.Der gleiche Werth der Theilung für die Lättenlänge l ist durch die Gleichung angedeutet.Für eine andere Lattenlänge l' wäre das
entsprechende h_1=h\,\frac{l'}{l},weil
\triangle\,ABC\sim\triangle\,ADE. Durch Substitution
des für h erhaltenen Werthes wird:
h_1=\frac{l'}{l}\,h'\,\frac{l}{r}. Nach früher ist
\frac{l}{r}=c, daher:
h_1=\frac{l'}{l}\,ch'.Wählt man also eine andere Lattenlänge, welche der Theilung des vorhandenen
Limbus nicht entspricht, so wird man, um die der neuen Lattenlänge l' entsprechenden Höhenunterschiede der
Endpunkte zu erhalten, die gegebene Ablesung ch' mit dem Verhältniss der neuen Lattenlänge l' zu jener Lattenlänge l, welche der Theilung des vorhandenen Limbus entspricht, zu
multipliciren haben. Nach den vorausgeschickten Erörterungen
dürften diesem in Fig. 3 und
4 in 1/10 n. Gr. dargestellten Instrument nur wenige Worte beizufügen sein. Die
Höhe desselben ist derart bemessen, daſs damit, ohne sich biegen zu müſsen, bequem
gearbeitet werden kann.
Zur Handhabung des Zirkels befindet sich am Kopf ein Arm H, welcher in der Verticalebene durch die Drehungsachse der Zirkelschenkel
in verschiedene Lagen gedreht werden kann. Diese Handhabe kann dazu benutzt werden,
um eine Winkeltrommel zum Abstecken der Profilrichtung aufzusetzen, und da die
Bewegung dieser Handhabe in der Verticalebene durch die Drehungsachse erfolgen kann,
so sind bei dem Umstand auch Visuren längs sehr steiler Lehnen möglich.
Der nach dem erwähnten Principe getheilte Limbus ist am Zirkelkopf derart befestigt,
daſs der Theilungsmittelpunkt des Limbus und der Drehungsmittelpunkt des Pendels P in die Drehungsachse der Zirkelschenkel fallen.
Selbstverständlich könnte der Limbus sammt dem Pendel an einer beliebigen Stelle des
Zirkels befestigt werden; es wäre daran nur die Bedingung geknüpft, daſs der
Pendelzeiger bei horizontaler Stellung der Zirkelspitzen auf Null einspielen
müſste.
Die Zirkelschenkel Z sind durch die Spange S versteift. Auſser Gebrauch kann der Zirkel
zusammengeklappt und die Schenkel durch einen Riemen festgeschnürt werden. Zu dem
Zwecke kann die Schraube, welche die Spange an dem einen Ende festhält, gelüftet und
nach der Drehung um den zweiten Befestigungspunkt letztere am entsprechenden
Zirkelschenkel befestigt werden. Damit das Instrument beim Transporte nicht
beschädigt werden kann, ist der Zirkelkopf mit dem Limbus in einem Gehäuse
verwahrt.
Soll das Instrument richtige Ablesungen geben, so muſs der Zeiger des Pendels P bei horizontaler Lage der Zirkelspitzen auf Null
einspielen. Bedient man sich zur Prüfung des Instrumentes einer schiefen Ebene, so
muſs die Differenz der ersten und der nach der Drehung des Instrumentes um 180° in
derselben Verticalebene erhaltenen Ablesung gleich Null sein:
\alpha-\beta=0. Ergibt sich bei dieser Untersuchung ein
Fehler F, so wird derselbe dadurch berichtigt, daſs der
Limbus nach Lüftung der Schraube R um den Werth
F=\frac{\alpha-\beta}{2} entsprechend gedreht wird.
Die Aufnahme der Profile geschieht in der Weise, daſs der Zirkel in der abgesteckten
Profilsrichtung entweder durch Drehung um eine der Spitzen, oder durch Ueberstellen
um eine Zirkelconstante fortbewegt wird; ein sehr geringes Neigen des Instrumentes
wird genügen, damit das Pendel zur Ruhe gebracht und dadurch die Ablesung sofort
gemacht werden könne. Ob man der abgesteckten Profilsrichtung folgt, hiervon kann
man sich leicht mit Hilfe der oberen Limbuskante überzeugen. Die Anordnung einer
besonderen Visurvorrichtung würde das Instrument unnöthig vertheuern.
Während der Arbeit können die gemachten Ablesungen in einer nach dem in Fig.
5 veranschaulichten Muster angefertigten Tabelle eingetragen und das
entsprechende Profil kann übersichtshalber in der Rubrik „Anmerkung“ nach
dem Augenmaſse graphisch dargestellt werden. Uebrigens wird sich die Anordnung der
diesbezüglichen Aufzeichnungen nach den jeweiligen Verhältnissen und nach den
während der Arbeit auftretenden Bedürfnissen regeln.
Das Auftragen der Profile gestaltet sich sehr einfach. Vor allem werden die in der
Natur gemessenen Höhen auf einer Verticalen VV' (Fig.
6) in einem bestimmten Maſsstabe aufgetragen und durch die erhaltenen
Punkte die Parallelen I, II, III u.s.w. gezogen. In dem
nämlichen Maſsstabe wie die aufgetragenen Höhen wird der Zirkelconstanten des
Instrumentes entsprechend ein gewöhnlicher Zirkel geöffnet. Vom Punkte I ausgehend schneidet man mit dieser Zirkelöffnung in
der Reihenfolge alle Parallele und die erhaltenen Punkte 1, 2, 3 u.s.w. geben
verbunden das Bild des aufgenommenen Profiles.In jedem Wendepunkte des Profiles errichtet man neue Verticale VV' und verfährt wie bereits
angegeben.
Wurde die Zirkelconstante auf Bruchtheile eingestellt und die entsprechende Ablesung
im früher erwähnten Sinne corrigirt, so ist dies beim Auftragen an der bezüglichen
Profilstelle zu berücksichtigen.
Dieses Instrument soll der Hauptsache nach das Profiliren durch das sogen.
„Abwägen“, oder „Staffeln“ ersetzen, kann in beschränkten Räumen,
wie z.B. in Fundamenten u.s.w., sowie zu den verschiedensten Operationen, im
Nothfalle, wenn kein feines Nivellirinstrument bei der Hand wäre, auch für rohe
Nivellirungen verwendet werden.
Beim Profiliren durch das Staffeln sind bekanntlich drei Stücke,
d. i. die Setzlatte, Abwagelatte und eine Libelle, erforderlich. Abgesehen, daſs die
Libelle an die Abwagelatte befestigt werden kann, und daſs der zur Handhabung
derselben nöthige Mann entfällt, so sind zur Bedienung der Abwage- und Setzlatte
dennoch zwei Mann unbedingt nöthig, während der Ingenieur als dritter die
Aufzeichnungen der Ablesungen zu besorgen hat.
Der Profilzirkel ist sehr bequem und gegenüber den zum Abwägen
nöthigen Apparaten sehr leicht gehalten. Während der Arbeit ist zur Handhabung
desselben nur ein Mann nöthig; dabei notirt der Ingenieur als zweiter die
Ablesungen. Es wird demnach bei dieser Art der Profilirung gegenüber den Staffeln
immer ein Mann erspart, im Nothfalle kann derjenige, welcher mit dem Zirkel
arbeitet, auch die Ablesungen aufschreiben, was beim Staffeln unmöglich ist.
Das Profiliren mit dem Zirkel kann in Folge der leichteren
Fortbewegung viel schneller als nach der Methode des Staffelns erfolgen; das
schwingende Pendel kann, um die Ablesung rasch machen zu können, durch ein geringes
Neigen des Limbus schnell zur Ruhe gebracht werden. Beim Staffeln hingegen müſsen
die von zwei verschiedenen Individuen abhängigen Operationen des Horizontalstellens
der Abwagelatte und des Senkrechtstellens der Setzlatte vorangehen, bevor zur
Ablesung geschritten werden kann.
Den Profilen, welche durch das Staffeln aufgenommen werden, liegen
die horizontalen Projectionen der mit der Abwagelatte gemessenen Terrainlängen und
die entsprechenden Höhenunterschiede der Terrainpunkte als Constructionselemente zu
Grunde; mit dem Profilzirkel hingegen werden die wirklichen Terrainlängen gemessen
und die Profile mit Hilfe dieser und der den Zirkelconstanten entsprechenden
Höhenunterschiede der Terrainpunkte erhalten.Das beschriebene Instrument wird durch den Mechaniker und Libellenfabrikanten
Hrn. Wenzel Reinisch in
Wien, IV Kolschitzkygasse Nr. 3,
angefertigt.
Tafeln