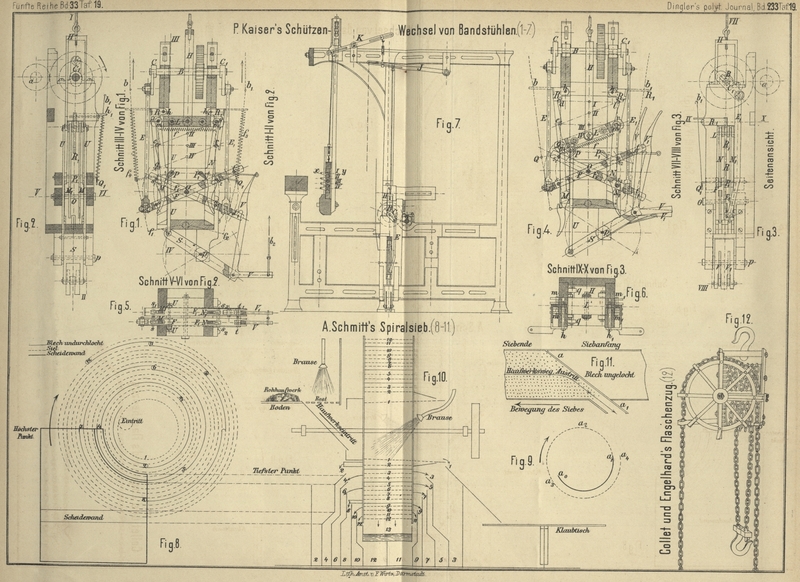| Titel: | A. Schmitt's Spiralsieb mit ungebrochenen Sieben. |
| Autor: | S–l. |
| Fundstelle: | Band 233, Jahrgang 1879, S. 202 |
| Download: | XML |
A. Schmitt's Spiralsieb mit ungebrochenen Sieben.
Mit Abbildungen auf Tafel 19.
A. Schmitt's Spiralsieb mit ungebrochenen Sieben.
Wenn bei der Verwendung concentrischer Siebtrommeln zum Sortiren der Massen jedes
Sieb nur solches Haufwerk zurückhalten und zum Abtragen fertig stellen soll, von
welchem nichts mehr die Maschenweite zu passiren vermag, so würde hierzu nothwendig
sein, daſs das Sieb, unter Voraussetzung einer genügenden, sich nach der
verschiedenen Korngröbe bestimmenden Länge, die auf einen Umgang zu verarbeitende
Masse gleichzeitig, bei Beginn seines Laufes, zugeführt erhielte und mit Beendigung
des Weges die auf ihm zurückbleibenden Theile abgestrichen würden, um neuem Haufwerk
Raum zu geben. Ein solches Resultat würde sich erzielen lassen, wenn man zwischen je
zwei Trommelsiebe einen Blechcylinder einschaltet, auf dem der gesammte Durchfall
des ersten Siebes sich sammelt und durch einen in jenem befindlichen Schlitz
gleichzeitig dem nächsten Siebe zugeht. Bei solcher Construction aber müſste,
besonders für eine gröſsere Zahl herzustellender Korngröſsen, der Apparat äuſserst
umfangreich und unverhältniſsmäſsig schwer werden; auch würden, wenngleich die
Sieblänge um so gröſser sein muſs, je feiner das zu behandelnde Haufwerk ist, doch
bei den rasch zunehmenden Halbmessern die Siebflächen viel gröſser werden, als zu
einer Durcharbeitung erforderlich ist.
Um nun möglichst viele Siebe in einem Apparate vereinigen zu können, dabei aber den
angeführten Uebelständen zu entgehen, schlägt A.
Schmitt in Biebrich (*D. R. P. Nr. 2550 vom 9.
August 1877) vor, die sämmtlichen Siebe, unter Einschaltung eines Stückes
ungelochten Bleches zwischen je zwei derselben, zu einer einzigen Fläche zu
vereinigen und diese, wie Fig. 8 Taf.
19 zeigt, spiralförmig mit je 55mm Zwischenraum
aufzurollen. Hierbei geht der Erfinder von folgender Betrachtung aus.
Wenn Fig. 9 einen Theil eines solchen Spiralsiebes darstellt, so wird, da der
Theil a0
a1 ungelocht ist, das
Siebstück a3
a4 keine directen
Zugänge vom darüber liegenden gröberen Siebe erhalten, sondern den Rest des bereits
auf a1
a2 und a2
a3 aufgefallenen
Haufwerkes rein arbeiten, natürlich unter Voraussetzung genügender Länge. Bei a4 würde durch eine
aufgesetzte schräge Leiste (vgl. Fig. 11)
das bis dahin gelangte gröbere Material seitwärts abgeführt, und beginnt hinter
dieser Leiste das nächst feinere Sieb mit dem ungelochtem Theile. Das letzte feinste
Sieb gibt das Durchgehende direct in den in Fig. 10 mit
13 bezeichneten Kasten ab, während die übrigen Sorten, wie die in Fig. 10
eingesetzten fortlaufenden Nummern anzeigen, abwechselnd nach beiden Seiten
abgetragen werden.
A. Schmitt berechnet, daſs bei dem angegebenen
Zwischenraum zwischen den Siebflächen und dem Durchmesser von 1m für das innerste Sieb der äuſsere Durchmesser
für Herstellung von 10 Korngröſsen 2m,2, von 15
Korngröſsen aber 2m,68 betragen müsse, und gibt
an, daſs ein für 7 Sorten eingerichtetes derartiges Spiralsieb von 35cm Breite nebst einer an derselben Achse
befindlichen Waschtrommel zu seiner Inganghaltung nur 0e,15 bedürfe. Zu Bewässerung der Massen soll die Einführung von Wasser in
das innerste Sieb mittels Brause vollkommen genügen.
S–l.
Tafeln