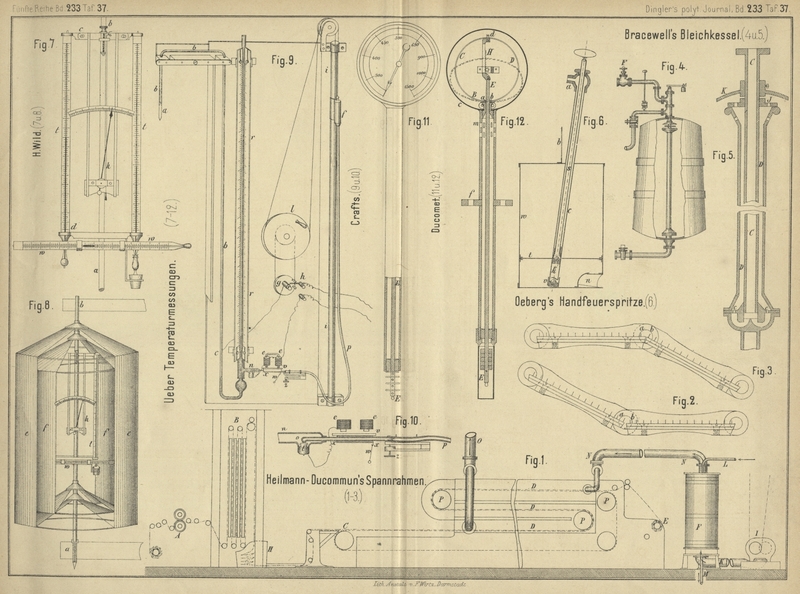| Titel: | Bracewell's Bleichkessel. |
| Autor: | Kl. |
| Fundstelle: | Band 233, Jahrgang 1879, S. 368 |
| Download: | XML |
Bracewell's Bleichkessel.
Mit Abbildungen auf Tafel 37.
Bracewell's Bleichkessel.
Die Hochdruckbleichkessel wurden eingeführt, um die Zeitdauer des Kochens der
Baumwolle abzukürzen, und zwar gibt es vier solcher Kochapparate, den Pendelbury'schen mit eigenem Siedekessel für die
Bleichflüssigkeit und besonderem Kochkessel für die Baumwolle, den Barlow'schen mit zwei communicirenden Kochkesseln für
die Waare, das combinirte Pendelbury-Barlow-System und
das in Deutschland als Mülhauser System bekannte, bei
welchem eine auſserhalb des Kochkessels befindliche Rotationspumpe den Umlauf der
Bleichflüssigkeit im Innern des Kessels bewirkt. Letzteres System bietet den
Vortheil, daſs es sich leicht aus einem schon im Gebrauch befindlichen eisernen
Niederdruckkessel herstellen läſst, und leistet auch sonst ganz gute Dienste. Bei
Neueinrichtungen hat sich der Barlow'sche Kessel am meisten Eingang verschafft, und
da sich ihm der neue Bracewell'sche Kessel eng
anschlieſst, so muſs eine kurze Besprechung desselben der Beschreibung des letzteren
vorausgehen.
Der Barlow'sche Hochdruckapparat besteht aus zwei dicht verschlossenen Kesseln A und B, in welche die
Waare eingelegt wird. Angenommen, Kessel A enthalte die
Bleichflüssigkeit und habe so lange gekocht, daſs es Zeit ist, die Flüssigkeit in
den Kessel B hinüber zu treiben, so schlieſst man das
Rohr, welches vom Deckel des Kessels A zum Boden des
Kessels B führt, öffnet dagegen die entsprechende
Verbindung zwischen dem Boden von A und dem Deckel von
B und läſst die Bleichflüssigkeit durch den von
oben in A eintretenden Dampf nach B hinüberdrücken, bis dieser Kessel mit der Flüssigkeit
von oben gefüllt ist und ersterer keine solche mehr enthält. Dieses Füllen und
Leeren von A und B
wiederholt sich während der Kochzeit mehrere Male.
Bracewell macht nun geltend, daſs das Ueberströmen der
Flüssigkeit von einem Kessel zum anderen bis zu ½ Stunde Zeit beanspruche, daſs
während des Hinüberdrückens der Flüssigkeit die oberen Schichten der eingelegten
Waare des sich entleerenden Kessels längere Zeit der Einwirkung des Dampfes in
halbtrockenem Zustand blosgelegt seien, also leicht im Faden geschwächt werden
können. Ferner findet er eine Gefahr für die Festigkeit der oberen Schichten der
Waare darin, daſs letztere beim Hinüberdrücken der Kalkflüssigkeit ungelöste Theile
des Kalkes gleich einem Filter zurückhalten und dann beim Zutreten des Dampfes ohne
Anwesenheit einer Flüssigkeit von der zurückgebliebenen Kalkschicht verbrannt, d.h.
morsch werden. Endlich fürchtet er das stürmische Kochen in diesem Apparat, welches
leicht ein Durcheinanderwerfen der Schichten der eingelegten Waare veranlassen
kann.
Der von Bracewell in Brinscell bei Manchester
construirte Kochapparat soll diese Uebelstände vermeiden. Derselbe ist so
eingerichtet, daſs ein Kessel für sich allein, oder auch zwei in Verbindung mit
einander arbeiten. Er hat, wie aus Fig. 4 Taf.
37 ersichtlich, eine schwach conische Form, welche eben die eingelegte Waare, wenn
sie durch das Kochen sich bewegen und heben wollte, in dieser Bewegung zurückhalten
soll. Die Waare wird wie gewöhnlich eingelegt; auch sonst weicht die Bedienung des
Kessels von der des Barlow'schen Kessels nicht ab. Ehe man die Bleichflüssigkeit in
denselben eintreten läſst, verdrängt man zuerst die Luft durch einströmenden Dampf.
Ist die Waare von der Flüssigkeit genügend überdeckt, das Mannloch geschlossen und
alle Hähne geschlossen, so läſst man durch den Ventilhahn F den Dampf vorsichtig eintreten.
Das Dampfrohr C (Fig. 5), in
welches der Dampf von oben einströmt, ist von einem zweiten, guſseisernen Rohre D umgeben, welches oben ausgeschweift, unten
ausgebaucht und mit einem Deckel verschlossen ist. Auf dem oberen Ende des Rohres
D liegt eine Scheibe J
lose auf, welche das Dampfrohr C umschlieſst und an
demselben auf und nieder gleiten kann, während der Schirm K oberhalb der Scheibe J an dasselbe
Dampfrohr C festgeschraubt ist.
Vor dem Einlassen des Dampfes steht die Bleichflüssigkeit im Kessel und im Rohr C gleich hoch; durch den Dampf wird sie in letzterem
nieder, in das äuſsere Rohr D hinüber- und
hinaufgedrückt, hebt dort die Platte J und ergieſst
sich in einem durch den Schirm K von oben begrenzten
Strahl oder Sprudel über die eingelegte Waare. Dann senkt sich die Platte wieder,
durch die Oeffnungen bei c dringt neue Flüssigkeit in
das Rohr nach, um vom Dampf in die Höhe gedrückt von neuem die Platte J zu heben und wie zuvor auf demselben Weg und in
derselben Form in den oberen Theil des Kessels zu gelangen. Indem sich die Platte
ungefähr einmal in der Secunde hebt und senkt, verursacht sie ein fortgesetztes
Klingen und zeigt eben dadurch das fortgesetzte, regelmäſsige Umlaufen und Kochen
der Bleichflüssigkeit an.
Der Kessel hat sich schon erprobt und wird der geringe Dampfverbrauch desselben,
sowie das sichere, einfache und rasche Arbeiten mit demselben gerühmt. Er theilt
sich überdies mit dem Mülhauser System in den Vortheil, daſs jeder im Gebrauch
befindliche eiserne Bleichkessel durch blose Einfügung des Rohres D, bezieh. der Rohre C und
D, sich für die Einführung des neuen Systemes
verwenden läſst.
Kl.
Tafeln