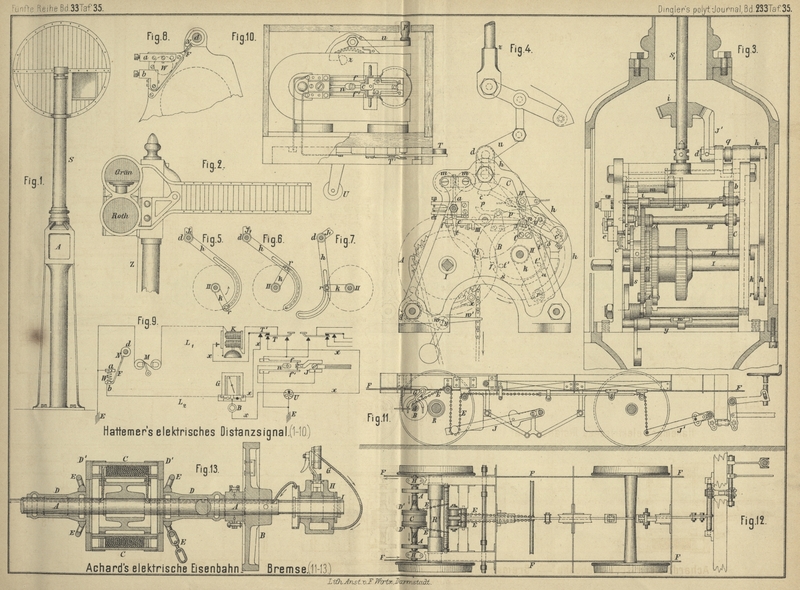| Titel: | Aug. Achard's elektrische Eisenbahnbremse. |
| Autor: | E–e. |
| Fundstelle: | Band 233, Jahrgang 1879, S. 379 |
| Download: | XML |
Aug. Achard's elektrische Eisenbahnbremse.
Mit Abbildungen auf Tafel 35.
Achard's elektrische Eisenbahnbremse.
Während Aug. Achard in Paris
früher die Bremsung durch Unterbrechung des Ruhestromes in einem über den ganzen Zug
laufenden Stromkreise bewirkte, damit bei etwaigem Zerreiſsen des Zuges dieser
automatisch gebremstUeber elektrische Bremsen vgl. auch 1878 227 310.
*230 111. würde, läſst er jetzt,
was erfahrungsgemäſs vorzüglicher ist, den elektrischen Strom die Räder bremsen und
sichert durch besondere Vorrichtungen das schnelle Anziehen der Bremsen im Falle der
Zug reiſst, entgleist oder in Brand geräth. Durch Anwendung einiger Plantschen
Elemente (vgl. 1876 221 389) häuft Achard, während die Apparate ruhen, die Elektricität
an, welche zum Bremsen Verwendung finden soll. In dem Versuchszuge, welcher seit
mehreren Monaten auf verschiedenen Abschnitten der Nordbahn läuft, sind zwei
Batterien aufgestellt, die eine in dem Packwagen an der Spitze, die andere im
Packwagen am Ende des Zuges; sie bestehen aus 4 Plantschen Elementen, die jedes
durch 3 Elemente mit Kupfervitriolfüllung geladen werden. Die Batterie an der Spitze
arbeitet allein bei der Hinfahrt; zurück wird der Zug mit dem hinteren Packwagen
angehängt und nun arbeitet die in diesem befindliche Batterie allein. Die Bremsung
veranlaſst entweder der Zugführer oder der Locomotivführer.
Jeder Wagen besitzt eine der Radachse R (Fig. 11 bis
13 Taf. 35) parallele, am Rahmen angebrachte Welle A; auf dieser sitzen zwei Reibungsräder B, mittels deren die Achse R die Welle A beständig mit in Umdrehung
versetzt. Lose sind weiter auf A zwei Muffe D mit eisernen Scheiben D'
aufgesteckt, zwischen denen der fest auf A aufgekeilte,
vierpolige Elektromagnet C liegt. Die zwei rechts und
links am Rahmen entlang dem Wagen laufenden isolirten Stromleiter F sind durch einen in die Welle A eingelegten isolirten Leiter durch den Elektromagnet C hindurch mit einander verbunden; dieser Leiter tritt
durch das mittels
Holzkeilen I gegen A
isolirte Lager H hindurch. An den Muffen sind die
Ketten E befestigt, welche über mehrere Rollen laufen
und das freie Ende der groſsen Hebel J, J' (Fig.
11) tragen, mittels deren die Bremsklötze angedrückt werden.
Mit dieser Bremse läſst sich ein mit groſser Geschwindigkeit fahrender Zug in ⅓
Minute bremsen, und die Erfahrung hat die Befürchtungen, daſs eine so schnelle
Unterdrückung der Drehung der Räder diesen schaden werde, als nicht berechtigt
nachgewiesen. Da nämlich die Uebertragung von R auf A blos durch die Reibung erfolgt, so mäſsigt das
eintretende Gleiten die zu heftige Wirkung, welche bei plötzlichem Stillstand
auftreten würde, und bei den seit mehreren Jahren angestellten zahlreichen Versuchen
ist nie ein Bruch durch den Stoſs zwischen den einzelnen Theilen eingetreten.
Der sich bei G abzweigende Strom kommt beiderseits über
das am Rahmen befestigte guſseiserne Lager, geht von da zu dem kupfernen Cylinder,
der durch Keile aus hartem Holz auf der Achse A des
Elektromagnetes befestigt ist, und in einem mit Guttapercha isolirten Kabel in den
Elektromagnet. Er wird durch Drücken auf einen Knopf oder Ziehen an einem Seile
geschlossen und bewirkt, daſs der Elektromagnet C die
Scheiben D' festhält, also die Muffe D mit in Umdrehung versetzt, die Ketten E aufwickelt und die Räder bremst. Bei Unterbrechung
des Stromes fallen die Hebel J, J' wieder herab und
entfernen die Bremsbacken von den Rädern. Um den remanenten Magnetismus in C beim Unterbrechen des Stromes unschädlich zu machen,
hat Achard an eine Umkehrung des Stromes gedacht, bald
jedoch erkannt, daſs eine solche nur mit äuſserster Vorsicht und unter Schwächung
des Stromes angewendet werden kann. Deshalb führt Achard lieber das rasche Lüften der Bremsen durch Vergröſserung des
Kopfendes des groſsen Hebels herbei und eine Neigung der ihn tragenden Ketten von
etwa 1/10 gegen
die Achse der Muffe, worauf sie sich aufwickeln; diese Neigung genügt, um eine
Componente zu liefern, welche den Muff von der Scheibe abzureiſsen vermag, an
welcher ihn der Magnetismus festhält. Die unserer Quelle (Bulletin de la Société d'Encouragement, 1879 Bd. 6 S. 169) beigegebene
Tabelle über die Versuche auf der französischen Nordbahn zeigen Schwankungen in der
bis zum Stillstand verflossenen Zeit zwischen 9 und 34 Secunden, und in dem vom Zuge
noch durchlaufenen Wege zwischen 61 und 405m. Auch
über die auf der französischen Ostbahn angestellten Versuche berichtet unsere
Quelle.
E–e.
Tafeln