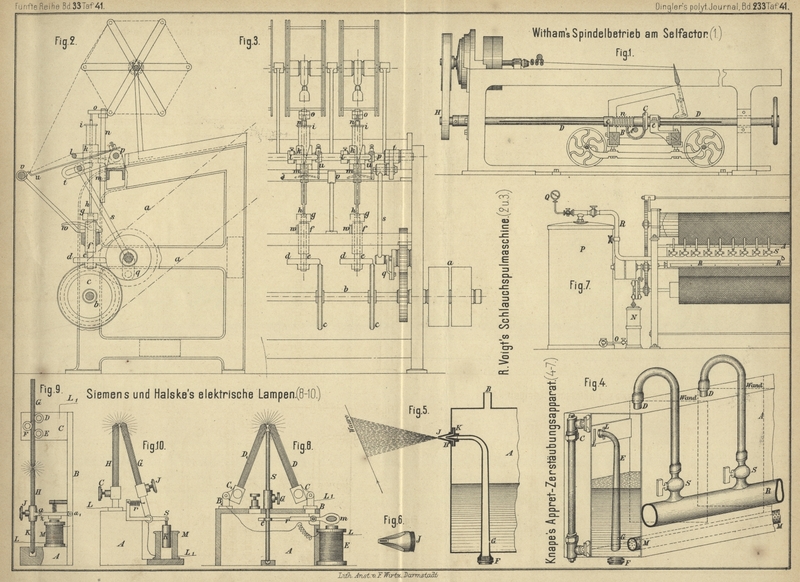| Titel: | Schussspulmaschinen von Rudolph Voigt in Chemnitz. |
| Autor: | E. L. |
| Fundstelle: | Band 233, Jahrgang 1879, S. 453 |
| Download: | XML |
Schuſsspulmaschinen von Rudolph Voigt in
Chemnitz.
Mit Abbildungen auf Tafel 41.
R. Voigt's Schuſsspulmaschinen.
Auf der in Fig. 2 und
3 Taf. 41 dargestellten Maschine (*D. R. P. Nr. 1804 vom 8. Januar 1878)
wird das Garn in sehr steilen Windungen auf die blanke Spulmaschinenspindel
gewickelt. Aus der vollendeten Spule zieht man die Spulmaschinenspindel heraus und
legt diesen Kötzer in eine Webschütze ohne Spindel ein, worauf dieselbe gewöhnlich
durch einen Blechdeckel geschlossen wird. Der Faden zieht sich vom Anfang der
Schlauchspule ab, wird also von innen heraus abgewebt.
Die durch den Riemen a bewegte Welle b treibt durch stehende Scheiben c die horizontal liegenden Teller d, welche an hohlen Wellen e befestigt sind, die in Gestellbüchsen f
laufen und oben einen Kopf g tragen; letzterer ist
dreieckig gelocht, um in diese Oeffnung das untere Ende der Spulenspindel h einstecken und hierdurch auch diese drehen zu können.
Oben ist diese Spindel rund und schwach conisch anlaufend geformt, sowie an zwei
gegenüber liegenden Seiten abgeflacht, einmal, damit das darauf gewickelte Garn
möglichst der Drehbewegung der Spindel folgt, und anderntheils, damit man die gefüllte
Schlauchspule leicht von der Spindel abziehen kann. Letzteres wird übrigens durch
Herunterschieben der oben aufgesteckten Scheibe i noch
unterstützt. Der von dem Haspel kommende Faden läuft um den feststehenden Stab v herum nach dem in vertikaler Richtung beweglichen
Auge des Drahtes w und zuletzt über den
Fadenführerfinger l in den guſseisernen, unten engen
und oben weiten Trichter k. Dadurch, daſs l sich auf- und abbewegt und die Spindel sich dreht,
werden Garnschichten auf letztere gebracht, welche zunächst die Trichterhöhlung
ausfüllen und weiterhin die Spindel nach jedem Hochgang oder Tiefgang des
Fadenführers um eine Fadenstärke heben, so daſs sich die nachfolgende Schicht um
ebenso viel tiefer liegend auf die obere aufwickelt. Sehr wichtig ist hierbei, daſs
die Spulung eine feste sei. Man legt deshalb noch oben auf die Spindel eine
Eisenscheibe o auf, die mit einem Stab n verbunden ist, welcher in der Führung m senkrecht beweglich steckt und je nach der
Spulendicke und Garnstärke entsprechend schwer gemacht wird. Um die Unterschiede in
der Fadenabwickelung von dem Haspel und in der Aufwindung auf die Spindel der Weite
des Trichters entsprechend auszugleichen, ist der Stab u lose auf der Stange p befestigt; u senkt sich mit dem Garn, sobald die Fadenspannung
kleiner wird, und hebt sich mit ihm, wenn der entgegengesetzte Fall eintritt.
Reiſst der Faden, so fällt u ganz herunter und legt sich
auf den Arm w, welcher drehbar an f befestigt ist und unter den Kopf g der Spindelbetriebswelle greift. Der Stoſs von u gegen w genügt, um g einige Millimeter hoch zu stellen und den
Reibungsantrieb zwischen c und d aufzuheben. Es bleiben demnach die Theile d, e,
g, die Spindel h und die Spule stehen, wenn
der Faden reiſst. Ebenso erfolgt auch Stillstand der Spindel, wenn die Spule fertig
ist. Es geschieht dies in der bekannten Weise, daſs nach Vollendung der Spule die
Spindel h so weit nach oben gerückt ist, daſs ihr
unteres Ende aus dem Kopfe g austritt und dessen
Drehung nicht weiterhin folgt.
Den Auf- und Niedergang der Fadenführerfinger l, welche
an der oscillirenden Stange p befestigt sind, bewirkt
die Kurbel q; dieselbe erhält von der Welle b durch Stirnräder ihre Bewegung und überträgt diese
durch Schubstange s und Arm t auf die Stange p.
Wesentlich bei Herstellung von Schuſsspulen ist, daſs der Fadenführer l sehr schnell auf und ab geht, so daſs nur eine
höchstens zwei Windungen in eine conische Schicht sich legen. Dies ist hier erzielt
durch das Uebersetzungsverhältniſs von b zu q. Man wählt es zumeist 1 zu 1½ und macht die Scheiben
c doppelt so groſs als die Teller d, so daſs für eine Umdrehung der Kurbel q die Spindel 3 Touren zurücklegt, also für den
Hochgang oder Tiefgang des Fadenführers 1½ Garnwindungen auf die Spule kommen.
Ein Hauptübelstand bei allen älteren Spülmaschinen, welche zum Bewickeln von Spulen
mit conischem Ansatz dienen, ist der, daſs bei constanter Drehgeschwindigkeit der
Spulen der sich darauf wickelnde Faden mit sehr verschiedener Geschwindigkeit
angezogen wird und demgemäſs ruckweise von seinem Haspel abläuft; kommt der Faden
auf das starke Ende des Spulenconus, so wird er sich sehr schnell aufspulen; gelangt
hingegen der Faden zu dem schwachen Kegelende, so wird er sehr langsam angezogen.
Dieses Wechseln der Spulgeschwindigkeit führt sehr leicht zu Fadenbruch und schlecht
gewickelten Spulen, und machen sich solche Uebelstände namentlich bei schwachen
Garnen sehr fühlbar.
R. Voigt in Chemnitz (* D. R. P. Nr. 1805 vom 10. Januar
1878) beseitigt dieselben (ähnlich wie Honegger bereits
in Wien 1873 sehen lieſs) an seinen Trichterspulmaschinen mit stehenden Spindeln
dadurch, daſs er zwischen die Schnurentrommel und die Antriebswelle zwei Stück
herzförmige Zahnräder einschaltet. Diese sind so construirt, daſs bei gleichmäſsiger
Drehung des treibenden Rades das davon getriebene sich ungleichmäſsig dreht, und
zwar zuerst mit zunehmender und alsdann mit abnehmender Geschwindigkeit. Es sind
ihre Halbmesser bezieh. Umfangsgeschwindigkeiten aus den verschiedenen Durchmessern
bezieh. Umfangsgeschwindigkeiten des conischen Ansatzes an der Spule berechnet, so
daſs die Trommel und die Spindeln mit ihren Spulen sich in solcher Weise drehen,
daſs die Umfangsgeschwindigkeit des Spulenconus an jeder Stelle des einlaufenden
Fadens immer eine gleich groſse ist.
E. L.
Tafeln