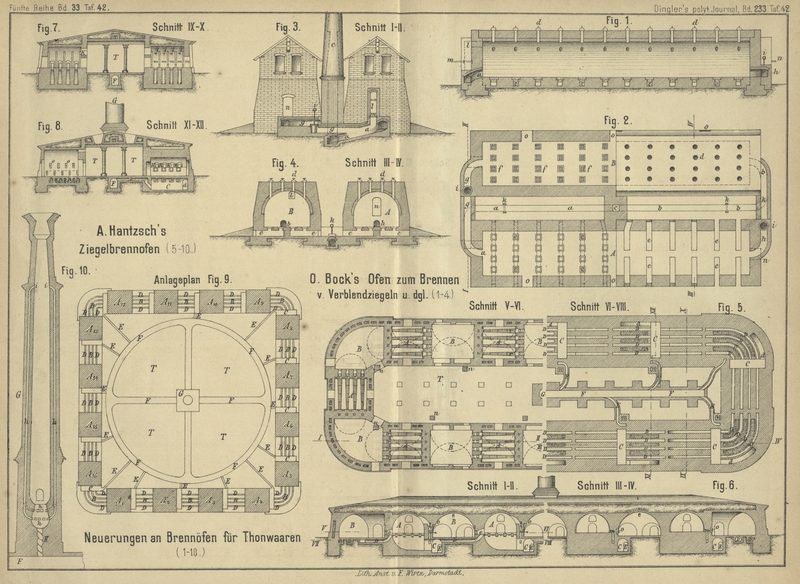| Titel: | Ueber das Brennen von Thonwaaren, Kalk, Cement und Gyps. |
| Fundstelle: | Band 233, Jahrgang 1879, S. 463 |
| Download: | XML |
Ueber das Brennen von Thonwaaren, Kalk, Cement
und Gyps.
(Fortsetzung des Berichtes von S. 382 dieses.
Bandes.)
Mit Abbildungen auf Tafel 42.
Ueber das Brennen von Thonwaaren, Kalk, Cement und
Gyps.
O. Bock (*D. R. P. Nr. 4222 vom 9. Juni 1878) hat auch
einen Ofen zum Brennen von Verblendziegeln und anderen
Thonwaaren construirt. Wie die Schnitte Fig. 1 bis
4 Taf. 42 zeigen, besteht der Ofen aus zwei gesonderten Abtheilungen A und B, welche durch die
theilweise unterirdischen Kanäle a und b mit dem Schornstein c in
Verbindung stehen. Die Befeuerung geschieht von oben durch die Heizlöcher d, während die erforderliche atmosphärische Luft durch
die Kanäle e zutritt, welche von auſsen unter der
Ofensohle zu je zwei senkrecht unter den Heizlöchern angebrachten Rosten f führen.
Zur Inbetriebsetzung des Ofens wird die Abtheilung A mit
den zu brennenden Thonwaaren vollgesetzt, indem um die Roste herum Heizschachte
senkrecht bis nahe unter die Heizlöcher aufgebaut werden. Dann mauert man die drei
Einkarrthüren o und die Oeffnung n zu, schlieſst die Glockenschieber i der die beiden Ofenabtheilungen verbindenden Kanäle
g und h und öffnet den
Schieber k im Fuchse a.
Das Anzünden geschieht mittels leicht brennbarer Stoffe, welche auf den Rosten der
beiden, der Oeffnung n am nächsten gelegenen, offenen
Kanäle e aufgehäuft wurden; die übrigen Kanäle sind
geschlossen. Der Schmauch- und Dampfkanal l wird erst
dann mittels des Schiebers m verschlossen, wenn die
Feuchtigkeit ausgetrieben ist. Sobald das Feuer, welches durch Nachheizen von oben
durch die Heizlöcher d im Gange gehalten wird, so
kräftig geworden ist, daſs die Steine über dem dritten Kanal anfangen zu glühen,
wird auch hier geheizt und werden die vorgemauerten Kanalthüren in demselben
theilweise geöffnet, während der erste Kanal wieder zugemauert wird. Erst nachdem
das Feuer beinahe bis nach dem entgegengesetzten Ende des Ofens gelangt ist, wird
der Verbindungskanal g zwischen dem brennenden Ofen A und dem zweiten B,
welcher bis dahin gefüllt und zugemauert sein muſs, durch Ziehen des
Glockenschiebers i geöffnet, der Schieber k im Kanäle a geschlossen
und im Kanäle b geöffnet, so daſs die Wärme jetzt die
Abtheilung B durchströmen muſs. Sobald die
Ofenabtheilung A abgebrannt ist (in der angenommenen
Ofengröſse von 24m Länge etwa 10 Tage nach dem Anzünden) und zur
Abkühlung gelangen kann, wird die Oeffnung n geöffnet
und die noch vorhandene Wärme in die Abtheilung B
eingezogen, um dort die Steine auszutrocknen und vorzuwärmen. Ist die Abtheilung A abgekühlt, so wird der Glockenschieber t im Verbindungskanale g
geschlossen und die Abtheilung B in derselben Weise
angefeuert und ausgebrannt wie die erste, welche während der Zeit ausgeschoben und
wieder gefüllt wird.
Der Ziegelbrennofen mit Rostfeuerung von A. Hantsch zu Miersdorfer Ziegelhütte (* D. R. P. Nr.
4454 vom 3. Mai 1878) besteht aus einzelnen Ofencapellen A mit dazwischen liegenden Trockenräumen B,
wie der Grundriſs, Längsschnitt und die beiden Querschnitte Fig. 5 bis
8 Taf. 42 eines Zehnkammerofens und der Grundriſs Fig. 9 eines
Ofens mit 16 Kammern zeigen. Die mit Mannlöchern zum Reinigen versehenen Kammern
stehen durch die 4 Heizkanäle D, welche den
Rostfeuerungen r entsprechen, und den Rauchsammlern C in Verbindung. Aus letzterer kann die während des
Betriebes abgesetzte Flugasche durch die Thüren d
entfernt werden. Jede Ofenkammer kann mit dem Schornstein G und dem Rauchsammler F durch die Kanäle E und deren Zugangsöffnungen n verbunden und auch ganz aus dem Betriebe ausgeschaltet werden.
Befindet sich der Ofen im Betriebe und ist z.B. die Kammer A1 (Fig.
9) leer, während A2 bis A9
fertig gebrannte, A14
bis A16 frisch
eingesetzte Steine enthalten, die Kammern A10 bis A13 aber im Vollfeuer stehen, so tritt die äuſsere
Luft in die offene Kammer A1 ein und geht durch die Heizröhren D und
sämmtliche Kammern, um von A16 aus in den Schornstein zu entweichen. In den Kammern A2 bis A9 sind mittels der
Sandtrichter o die Abzugskanäle l geschlossen und m geöffnet, die Klappen e zu den Kanälen D
heruntergelassen, so daſs die Luft die fertigen glühenden Steine durchzieht, abkühlt
und dadurch entsprechend vorgewärmt unter die Feuerungsroste der Kammer A10 bis A13
gelangt; hier sind die Abzugskanäle l offen, m geschlossen, am Ende der Feuerung werden aber die
Kanäle l geschlossen, m
geöffnet und die Stellklappen e heraufgezogen.
In den Kammern A14 bis
A16 sind die Abzugskanäle l und m geöffnet, die
Klappen e heruntergelassen; der Fuchs von A16 steht in Verbindung
mit dem Schornstein, während die Verbindung der anderen Kammern mit demselben
geschlossen und die Heizkanäle der Kammern A1 abgesperrt sind. Die
abgehenden Gase durchziehen daher die frisch eingesetzten Steine, schmauchen
dieselben vor und gehen angeblich mit nur 30° von A16 durch den Fuchs E
und den Rauchsammler F in den Schornstein. Nach je 24
Stunden rückt der Betrieb um eine Kammer weiter, so daſs dann Kammer A2 ausgekarrt ist, A1 mit frischen Steinen
besetzt wird u.s.f.
Der Schornstein G (Fig. 10)
zeigt sonderbarer Weise an seiner Mündung eine schraubenförmig aufsteigende Form H, welche sich nach oben erweitert und angeblich den
abgehenden Gasen eine drehende Bewegung gibt. Oberhalb dieses im Verhältniſs zum
Rauchsammler F jedenfalls zu engen
Schraubenmutterganges ist eine birnförmige Centralkammer, in welcher auſser der
gerade aufsteigenden Schornsteinröhre noch eine Anzahl enger Ventilröhren h einmünden, welche bei i
wieder austreten und deren erwärmte Luft die gerade aufsteigenden Gase erwärmen und
somit den Zug befördern soll.
Tafeln