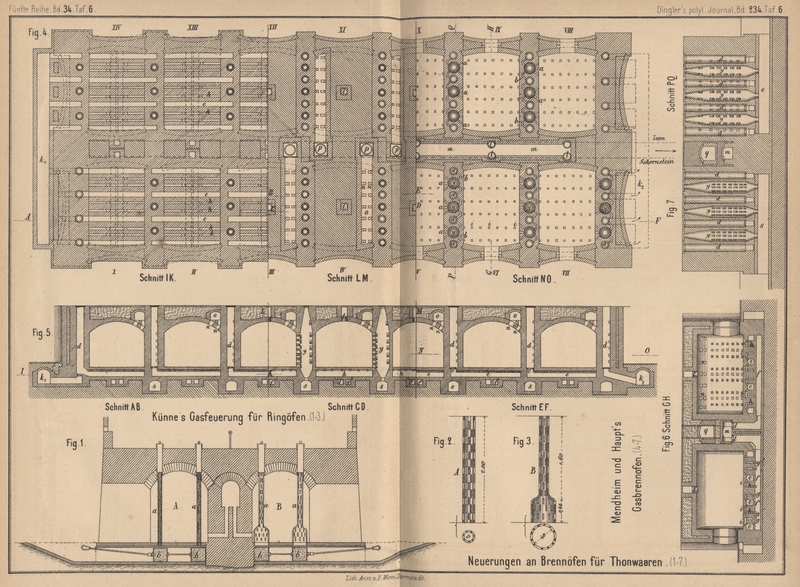| Titel: | Ueber das Brennen von Thonwaaren, Kalk, Cement und Gyps. |
| Fundstelle: | Band 234, Jahrgang 1879, S. 41 |
| Download: | XML |
Ueber das Brennen von Thonwaaren, Kalk, Cement
und Gyps.
(Fortsetzung des Berichtes Bd. 233 S.
463.)
Mit Abbildungen auf Tafel 6.
Ueber das Brennen von Thonwaaren, Kalk, Cement und
Gyps.
Ziegelöfen mit Gasfeuerung. Im
Anschluſs an die früheren Mittheilungen von Steinmann
(*1871 200 457. *1876 220
151), Mendheim (1874 214
207) und Nehse (* 1876 220
427) über Oefen zum Brennen von Thonwaaren mit Gas möge zunächst der Ofen von F. Künne in Colbitz (* D. R. P. Nr. 4470 vom 6. Juli 1878) besprochen
werden, dessen Einrichtung sich von den so genannten permanenten Heizschächten nur
wenig unterscheidet. Wie auf Taf. 6 der Querschnitt Fig. 1 durch
einen Ringofen zeigt, sind in jeder Kammer von den Heizlöchern bis zur Ofensohle
reichende Chamotteröhren a eingesetzt, welche mit einer
Anzahl Schlitze versehen wurden. Die Rohre in der Kammer A sind für Braunkohle, die in B für
Steinkohle bestimmt (vgl. auch A und B
Fig.
2 und 3).
Dieselben werden von oben in bekannter Weise beschickt. Von Zeit zu Zeit zieht man
den die Rohre nach unten abschlieſsenden Schieber, so daſs die Rückstände in die
Blechkasten b fallen und mit diesen herausgezogen
werden können. – Von einer eigentlichen Gasfeuerung kann hier demnach kaum die Rede
sein.
Minder einfach ist der Ofen von G.
Mendheim in Berlin und C. Haupt in Brieg (* D.
R. P. Nr. 634 vom 2. October 1877). Fig. 4 bis
7 Taf. 6 zeigen Grundriſs, Längsschnitt und zwei Querschnitte eines Ofens
mit 14 Kammern, in deren Zwischenwänden die Gasgeneratoren y liegen, welche von oben mit Brennstoff gefüllt werden. Dieselben stehen
durch die kleinen Oeffnungen a mit der vorhergehenden,
mit der nächsten Kammer aber durch die kleinen Oeffnungen b und die mittels Chamotteglockenventile c
verschlieſsbaren senkrechten Kanäle d und deren
Sohlenkanälen e in Verbindung.
Befindet sich nun z.B. Kammer VI im Vollfeuer, so sind
die Verbindungen derselben mit der Kammer V, IV und III einerseits und mit VII,
VIII und IX andererseits durch Hebung der
Ventile c in den Zwischenwänden geöffnet, diese Ventile
aber sowohl zwischen II und III, als auch zwischen IX und X geschlossen, ferner die Gasgeneratoren y zwischen V und IV mit glühendem Brennstoff gefüllt. Durch eine kleine
Durchbrechung der Chamotteplatte, welche die Lüftungsöffnung t der Kammer III verschlieſst, wird nun
anhaltend ein Wasserstrahl direct auf die noch glühenden Steine geleitet, ohne daſs
diese angeblich dadurch beschädigt würden. Der gebildete Wasserdampf strömt durch
die Oeffnungen in den Zwischenwänden nach Kammer IV und
V, tritt überhitzt durch die Oeffnungen a in das glühende Brennmaterial der Generatoren von VI, um hier Kohlenoxyd und Kohlenwasserstoffe zu
bilden. Das Gasgemisch tritt dann durch die Oeffnungen b, die Kanäle d und die Ventile c in die Sohlenkanäle e
der Kammer VI, um von hier mit Luft gemischt
auszutreten. Meist wird neben der Einführung von Wasser mittels eines Gebläses
atmosphärische Luft in dieselbe Kammer gepreſst, um mit dem Wasserdampf gemengt und
erhitzt in die gefüllten Generatoren zu treten.
Die zur Verbrennung der in Kammer VI eintretenden Gase
erforderliche atmosphärische Luft tritt entweder direct von auſsen in die Kanäle f, durch deren Oeffnungen g in die Kanäle h und aus diesen gemeinschaftlich mit dem Gase in die
Kammer, oder man läſst, wenn mit erwärmter Luft gearbeitet werden soll, diese in den
geöffneten Eingang von Kammer XIV eintreten, durch den
Verbindungskanal k1 und
die Kammer I nach Kammer II, welche von III durch ihre Glockenventile
c abgeschlossen ist, gehen, in deren Sohle sie
durch dieselben Oeffnungen, welche beim Brande den Luftzutritt vermitteln, durch das
geöffnete Glockenventil l der Kammer II, den Kanal m und das
geöffnete Glockenventil l der Kammer VI in diese gelangt, um hier in der vorhin angegebenen
Weise mit dem Gase zusammenzutreten. Die Rauchgase treten aus Kammer VI durch VII, den
Verbindungskanal k2 und
VIII sowie IX und
gelangen durch die Oeffnungen n im Gewölbe der Kammer
in den darüber liegenden Kanal o, von da durch das
geöffnete Rauchventil p in den Rauchkanal q und schlieſslich in den Schornstein. Unterhalb der
Generatoren einer jeden Kammer befindet sich ein von auſsen zugänglicher Kanal s, von welchem aus, nach Entfernung der den Boden des
Generators schlieſsenden Chamotteplatte, die Asche und Schlacken beseitigt werden.
(Vgl. auch Notizblatt des Vereines für Fabrikation von Ziegeln, 1877
S. 143. 1878 S. 65.)
Tafeln