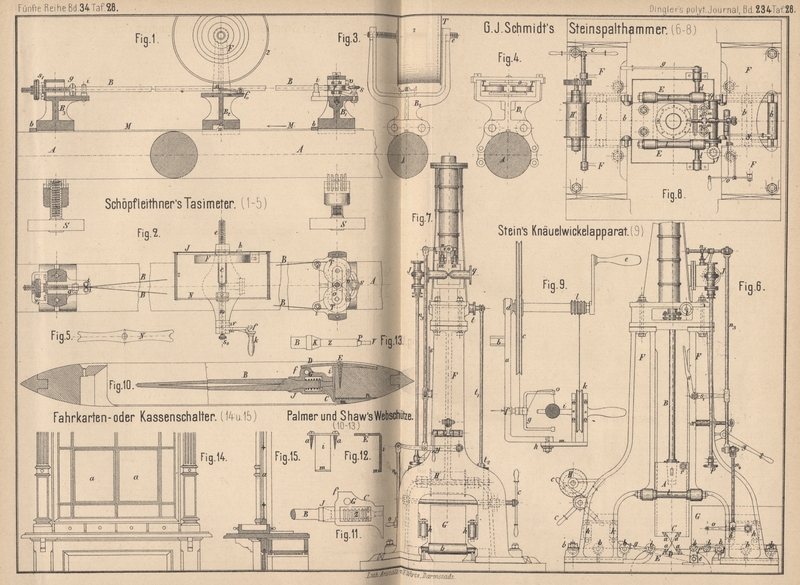| Titel: | Steinspalthammer von G. J. Schmidt in Gaumitz bei Nimptsch. |
| Autor: | J. P. |
| Fundstelle: | Band 234, Jahrgang 1879, S. 366 |
| Download: | XML |
Steinspalthammer von G. J. Schmidt in Gaumitz bei Nimptsch.
Mit Abbildungen auf Tafel 28.
G. J. Schmidt's Steinspalthammer.
Diese in Fig. 6 bis
8 Taf. 28 in verschiedenen Ansichten dargestellte Maschine (* D. R. P.
Nr. 719 vom 14. Juli 1877) dient zum Spalten der in den Steinbrüchen gewonnenen
parallelepipedischen Blöcke behufs Herstellung von Würfeln für die
Straſsenpflasterung. Dieselbe ist im Wesentlichen ein Dampfhammer mit keilförmigem
Hammer- und Amboſsstöckel, zwischen dessen Ständerfüſsen sich eine Vorrichtung zur
Zuführung der zu spaltenden Blöcke befindet.
Der Hammerbär A ist an der
Kolbenstange B befestigt und besitzt einen groſsen Hub;
er wird durch Dampf gehoben und fällt vermöge der eigenen Schwere herab, arbeitet
also nur mit Unterdampf. In seine untere Fläche ist die prismatische Stahlscheibe
C eingeschoben, welche durch Keile a auf beiden Seiten festgekeilt ist. Dieser Schneide
gegenüber ist auf der Chabotte E eine gleiche D mittels derselben Befestigung angebracht; die beiden
Schneiden C und D stehen
genau senkrecht über einander und sind parallel. Die beiden Seitenständer F des Hammers sind, wie die Seitenansicht Fig.
7 zeigt, in ihrem unteren Theile gegabelt, um den Raum für den zu
bearbeitenden Granitblock G zu schaffen. Letzterer
lagert auf Rollen b und wird mittels Kette
herangezogen, welche sich um die Trommel H der an dem
Gestell angebrachten Winde aufwickeln. Die Drehung der Trommel geschieht durch
Rädervorgelege und Windekreuz c.
Die Spitze der Schneide D liegt etwas
höher als die Rollen b, so daſs der Block auf diese
gehoben werden muſs. Zu diesem Zweck sind die zwei der Schneide zunächst gelegenen
Rollen in einem um die Achse d drehbaren Rahmen f gelagert, welcher durch ein Excenter e und den auf der Welle des letzteren aufgekeilten
Handhebel g gehoben werden kann. Seitlich ist die
Bewegung des Granitblockes durch die Rollen h
gesichert.
Die Ständer F sind auf gemeinsamer
Grundplatte befestigt, die Chabotte E auf einen
Granitblock und Holzunterlagen. Erstere sind mit Führungen für den Hammerbär
versehen, werden durch Querstangen l abgesteift und
tragen den Dampfcylinder.
Die Steuerung erfolgt durch Schieber m, welche durch die Hebel und Stangen n1 bis n4 mittels des Handgriffes o bewegt werden. J ist das
Einströmungsventil, dessen verlängerte Ventilstange zur Handhabung ein Handrädchen
p besitzt; der Dampf strömt bei q hinaus.
Um ein zu hohes Hinaufsteigen des Hammerbärs zu vermeiden, ist an
demselben eine Rolle r angebracht, welche an den
Winkelhebel s stöſst, wenn der Bär oben angelangt ist.
Der Hebel s reicht mit dem Arme s1 in eine Schleife der Stange n3 und schlieſst den
Einströmschieber, wenn der Bär in seiner obersten Stellung sich befindet.
Zum Ablassen des Condensationswassers aus dem unteren Theile des
Cylinders dient der Hahn t, der durch die Zugstange t1 und Hebel t2 bewegt wird. Soll
der Bär hoch bleiben, so wird der Stift x mittels des
Hebels y in ein entsprechendes Loch des Bars geschoben
und dieser dadurch festgehalten.
Die Maschine arbeitet folgendermaſsen: Nachdem der Block derart unter den Hammer
gebracht ist, daſs die untere Schneide D genau auf die vorgezeichnete Marke
trifft, wird derselbe heruntergelassen und mittels zweier an beiden Seiten
eingespannter senkrechter Drähte einvisirt. Wie beim Spalten eines Mauerziegels gibt
man zuerst mehrere schnell hinter einander folgende kurze Schläge mit geringer
Fallhöhe und dann einen starken Schlag mit groſser Fallhöhe, wodurch die Platte
genau senkrecht und mit ebener Fläche abspaltet. Würden die Schneiden nicht genau
übereinander stehen, so würde die Spaltungsfläche windschief werden. Der Block wird
wieder um eine neue Stärke vorgeschoben und das Spiel beginnt von neuem.
Die von dem Hammer kommenden Platten werden durch Linien eingetheilt und durch einen
kleineren Hammer in Würfel und Parallelepipeden gespalten. Die Einrichtung dieser
kleineren Maschine ist der Hauptsache nach dieselbe wie die der beschriebenen; nur
werden die Steine auf Tischchen anstatt Rollen gebracht, die auf mehreren
Spiralfedern ruhen, welche durch das Gewicht des aufgelegten Steines sich
zusammendrücken, so daſs der Stein auf die untere Schneide zu liegen kommt und in
dem gewünschten Gleichgewicht gehalten wird.
Bei aufmerksamer Bedienung ist auf eine erforderliche Nacharbeitung der fertig
gespaltenen Steine nur in geringem Maſse zu rechnen. Die von den Seiten abfallenden
Stücke geben Steine geringer Qualität. Mittels eines Hammers von 750k Gewicht wurden Blöcke mit einem einzigen Schlag
und in gewünschter Richtung mit vollkommen ebenen Flächen durchspalten. Für die
Schneiden haben sich dreiseitige Prismen von 60° Schneidewinkel am besten bewährt;
sie besitzen 3 Schneiden, welche man nach einander benutzen kann, und werden bei
Anwendung entsprechender Gesenke unter dem Hammer selbst ausgeschmiedet.
J.
P.
Tafeln