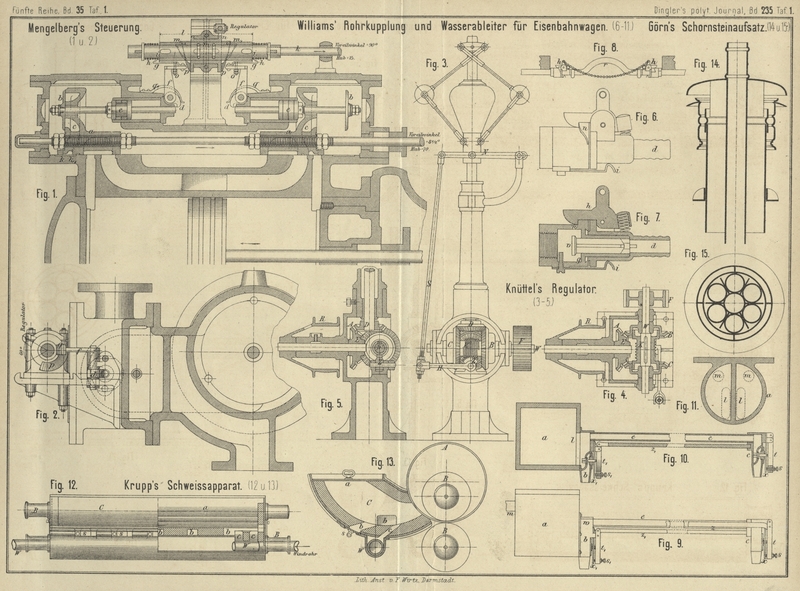| Titel: | Dampfmaschinen-Steuerung von C. Mengelberg, Betriebsleiter der Ottilienhütte zu Kittlitztreben bei Bunzlau. |
| Autor: | C. Mengelberg |
| Fundstelle: | Band 235, Jahrgang 1880, S. 6 |
| Download: | XML |
Dampfmaschinen-Steuerung von C. Mengelberg, Betriebsleiter der
Ottilienhütte zu Kittlitztreben bei Bunzlau.
Mit Abbildungen im Text und auf Tafel 1.
Mengelberg's Dampfmaschinen-Steuerung.
Die vorliegende Steuerung gehört zu den Präcisionssteuerungen mit allochroner
Auslösung, bei welcher der Auslösemechanismus durch ein eigenes Excenter bewegt wird
(vgl. 1879 233 11 und Allcock's Steuerung * 1876 220
395). Sie bezweckt einerseits möglichste Verringerung der schädlichen Räume,
andererseits schnellen Dampfabschluſs für jede beliebige Kolbenstellung und
verbindet den bewährten Schiebermechanismus mit entlasteten Ventilen; sie spart
daher die Arbeit der Reibung für die Expansionsvorrichtung, welche z.B. bei der
Meyer'schen Steuerung schon ganz beträchtlich werden kann. Die vom Regulator zu
leistende Arbeit ist sehr gering und läſst sich durch neuerdings angebrachte
Vorrichtungen noch bedeutend vermindern. Die in Fig. 1 und
2 Taf. 1 skizzirte Steuerung besteht aus dem Dampfvertheilungs- und dem
Auslösemechanismus.
Der Dampfvertheilungsmechanismus besteht aus zwei getrennten Schiebern a, welche sich von den Meyer'schen nur dadurch
unterscheiden, daſs die Durchlaſskanäle nicht auf der Rückseite des Schiebers,
sondern auf den Stirnseiten desselben ausmünden. Der Verschluſs dieser
Durchlaſskanäle erfolgt nicht mittels belasteter Schieber, sondern durch
Tellerventile b, welche im Augenblicke des Oeffnens
entlastet sind. Es liegt also kein Grund vor, dieselben durch weniger einfache
Doppelsitzventile zu ersetzen. Sobald die Kante k des
Schiebers die Kante k1
des Schieberspiegels überschritten hat, tritt durch den Kanal c Dampf von unten hinter das Ventil und gleicht die
Spannung im Kanäle mit dem im Schieberkasten herrschenden Drucke aus; es bleiben
also nur die Sitzflächen belastet. Der im Kanal c
enthaltene Dampf verhütet das völlige Leergehen des Kolbens und dient bei der
niedrigsten Füllung zum Schmieren des Cylinders. Hat der Schieber seinen gröſsten
Ausschlag erreicht, so springt die Knagge d vor das
Ende der mit Kolben e versehenen Ventilstange, dieselbe
bei der Rückwärtsbewegung des Schiebers in ihrer Lage fest und den Dampfkanal e offen haltend. Der Schluſs des Ventiles b geschieht durch den auf dem Kolben e lastenden Dampfdruck, sobald die Stellung der Knagge
d eine Rückwärtsbewegung der Ventilstange
gestattet. Indem nun die Feder q, welche die Knagge d nach abwärts drückt, entsprechend stark gewählt wird, um dem Dampfdruck
auf den Kolben der Ventilstange zu widerstehen, so kann der Rückgang des Ventiles
erst dann erfolgen, wenn die Knagge d durch eine
äuſsere Kraft – die des Auslösemechanismus – zurückgeschoben wird.
Als Verbindungsglied zwischen dem Dampfvertheilungs- und dem Auslösemechanismus dient
der Hebel f mit aufgenieteter Feder g. Die Wirkungsweise der Auslösung wird durch
nachstehende Skizze veranschaulicht, bei welcher der besseren Anschauung wegen die
einzelnen Stellungen des Auslösers gegen einander verschoben sind.
Textabbildung Bd. 235, S. 7Der Weg des Punktes h an der Feder g ist ein Bogen s vom
Radius r, der Weg der Auslösestange k eine Gerade A B, welche
den Bogen s stets in demselben Punkte c, dem Auslösungspunkte, schneidet. Die Totallänge l der Auslösungsmuffen ist durch den Regulator
variabel. Denkt man sich die Wege des Auslösers bei verschiedenen Längen l desselben parallel über einander aufgetragen, so
rückt selbstverständlich der Auslösungspunkt c auf der
zu A B Normalen B A1 bezieh. c c1, fort. Das ganze Parallelogramm A A1
B1
B gibt ein Bild aller möglichen Wege der Stangen k, das Dreieck A A1
B eine Darstellung der Wege für die Kante h; dieses enthält die vor,
das Dreieck B B1
A1 die nach der Auslösung zurückgelegten Strecken des Weges
von k. Da nun ein todter Punkt des Kolbens und ein
todter Punkt der Auslösestange (Voreilung 90°) der Zeit nach zusammenfallen, so ist
aus dem Diagramm sofort ersichtlich, daſs die Auslösung in jedem Punkte des
Kolbenweges stattfinden kann. Bei AB ist der Weg nach der Auslösung = 0 oder letztere erfolgt zu Ende des Weges der Stange k (volle Füllung); bei A1
B1 ist der Weg vor der Auslösung = 0, oder dieselbe erfolgt zu Anfang
des Weges der Stange k (0-Füllung). Hiernach läſst sich
die Füllung irgend einer Zwischenstellung z.B. A2B2 leicht übersehen, und es ist direct der
Füllungsgrad \frac{s_1}{s}=\frac{A_2B_2}{A_2c_2}.
Die Aenderung der Länge l ist durch folgende Einrichtung
erreicht. Der Regulator greift bei dem an die Lagerschale n angegossenen Hebel an und dreht dieselbe um ihre Achse. Ein in der Nuth
der Schale gleitender Keil läſst die Mittelhülse m an
der Drehung theilnehmen. Diese ist nur drehbar, die Seitenhülsen m1 sind dagegen nur
gleitbar auf der Stange k befestigt und stoſsen mit der
Mittelhülse m in Schraubenflächen mit Rechts- bezieh.
Linkssteigung zusammen. In Folge dessen wird bei Drehung von m das Hinaus- oder Hereinschieben der Seitenhülsen m1 erzielt. Die Stahlhülsen m1 wirken mit ihrer
äuſseren Stirnfläche i auf die Nase h der Feder g, den Hebel
f mitnehmend. Zur Regelung der Lage der Kante i und zur Ausgleichung von Abnutzungen ist eine
Stellschraube o an den Federn g angebracht.
Damit für jede beliebige Regulatorstellung der Anfangspunkt des Weges der Stange k nicht von der Linie A
A2
A1 abweicht (vgl.
Textfigur), der Hebel f mit der Feder g also nur so weit zurückfällt, daſs die Stirnfläche
i des Mitnehmers stets wieder vor die Kante h der Feder g kommt, um
den Hebel f fortzubewegen, befindet sich an der
Lagerschale ein mit derselben drehbarer schraubenförmiger Anschlag p.
Die Steuerung ist verhältniſsmäſsig einfach; allein sie bedarf wie wohl alle
Präcisionssteuerungen einer höchst sorgfältigen Ausführung und Wartung, wenn nicht
der Nutzen der Selbstregulirbarkeit und des raschen Dampfabschlusses hinfällig
werden soll.
Tafeln