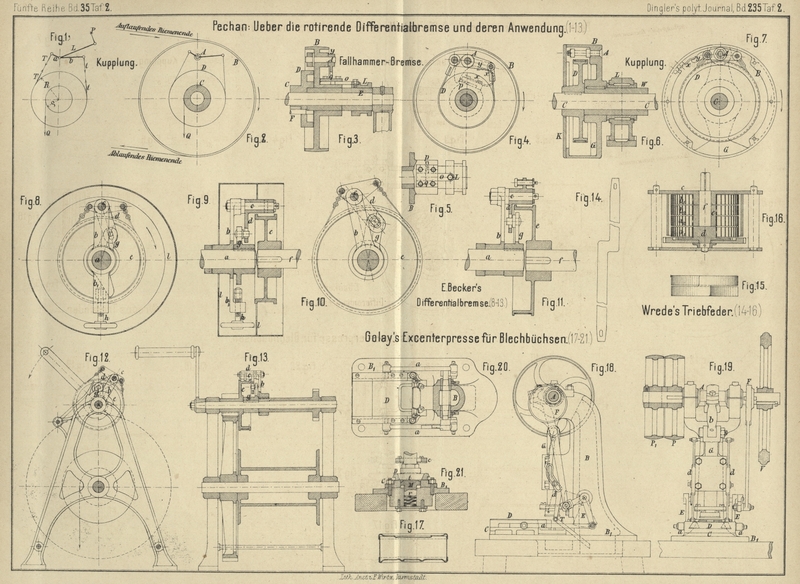| Titel: | Ueber die rotirende Differentialbremse und deren Anwendung; von Professor Josef Pechan. |
| Autor: | Josef Pechan |
| Fundstelle: | Band 235, Jahrgang 1880, S. 10 |
| Download: | XML |
Ueber die rotirende Differentialbremse und deren
Anwendung; von Professor Josef
Pechan.
Mit Abbildungen auf Tafel 2.
Pechan, über die rotierende Differentialbremse.
Bei der Differentialbremse sind bekanntlich in Hinsicht des anzuwendenden
Hebelverhältnisses und somit in Hinsicht der zum Bremsen einer bestimmten Last
erforderlichen, am Bremshebel wirkenden Kraft zwei Fälle zu unterscheiden, welche
wesentlich andere Constructionen bedingen, sobald davon abgesehen wird, daſs man
einfach mit der Hand den Bremshebel erfaſst, um die Bremse zu spannen oder zu lösen.
Letzterer Umstand kommt insbesondere in Betracht, wenn die Differentialbremse nicht
mit feststehendem Drehbolzen für den Bremshebel ausgeführt ist, sondern wenn
vielmehr dieser Bolzen selbst mit dem Bremsbande und der Bremsscheibe im Kreise
rotirt, also eine rotirende Differentialbremse
vorliegt, welche vom Verfasser in einer eigenen AbhandlungJosef Pechan: Ueber die rotirende Differentialbremse
und deren Anwendung bei Fallhämmern und Walzwerken mit
Wechseldrehung. (Wien 1878. Lehmann u.
Wentzel.) besonders behandelt wurde.
Bezeichnet, wie in Fig. 1 Taf.
2 angedeutet, Q die zu bremsende Last am Halbmesser ρ, R den Halbmesser der Bremsscheibe, a, b, L die Hebelarme des Bremshebels, an welchen der
Reihe nach die Bremsbandspannungen T und t beziehungsweise die durch Handdruck o. dgl. ausgeübte
Kraft P wirken, so hat man für das Verhältniſs der
Spannungen der Enden des Bremsbandes die bekannte Gleichung:
T=t\,e^{f\alpha}, . . . . . . . . . .
(1)
worin f den
Reibungscoefficienten zwischen Bremsband und Bremscheibe, α den vom Bremsband
umspannten Winkel, im Bogenmaſse für den Halbmesser gleich der Einheit, und e die Basis der natürlichen Logarithmen vorstellt;
ferner ergibt sich für die Bremsung der Last Q die
Gleichung:
Q\,\varrho+t\,R=T\,R . . . . . (2)
und endlich für den Gleichgewichtszustand am
Bremshebel, wenn P im Sinne des Pfeiles in Fig.
1 wirkt:
P\,L+T\,a=t\,b. . . . . . . (3)
Je nachdem nun die Auflösung der Gleichung (3) für P einen positiven oder einen negativen Werth ergibt,
muſs die Kraft P in dem einen oder in dem
entgegengesetzten Sinne zur Wirkung gelangen. Im ersteren Falle wirkt sie im Sinne
derjenigen Kraft, welche, wie der Pfeilrichtung in Fig. 1
entsprechend, zum Anziehen der Bremse erforderlich ist; im zweiten Falle dahingegen
wirkt die Kraft dieser Richtung gerade entgegengesetzt und ist somit zum Anziehen
der Bremse nicht erforderlich. Eine geringe absolute Vergröſserung der Kraft P im zweiten Falle bewirkt dasselbe wie eine
Verringerung derselben im ersten Falle; es wird nämlich jedesmal die Bremsung
vermindert. Ein der Gleichung (3) entnommener positiver Werth für P bedingt demnach für die Lösung der Bremse eine
Kraftabnahme und für das Spannen derselben eine Kraftzunahme, wogegen ein negativer
Werth für P zum Spannen der Bremse durchwegs auſser
Betracht bleibt und erst berücksichtigt werden muſs, wenn es sich um das Lösen der
Bremse handelt. Der letztere Fall ergibt eine Bremse, welche sich selbstthätig
weiter spannt, sobald das Bremsband durch die Einwirkung einer äuſseren Kraft,
welche der oben berechneten entgegengesetzt wirkt, so weit gespannt wird, daſs es an
der Bremsscheibe anliegt, sobald also überhaupt Reibung zwischen Bremsband und
Bremsscheibe eintritt. Die beiden vorgenannten Fälle sind mathematisch
gekennzeichnet durch das Hebelverhältniſs
\left(\frac{b}{a}\right) und zwar ist:
im ersten Falle
\frac{b}{a}>e^{f\alpha}, im zweiten Falle
\frac{b}{a}<e^{f\alpha}..
Die Differentialbremse, für welche \frac{b}{a}<e^{f\alpha},
besitzt die Eigenschaft, bei zunehmender Last Q sich bis zum
Bruche selbstthätig zu spannen. Die zur Ueberwindung der Steifigkeit des
Bremsbandes am Hebelarme L im Sinne des Pfeiles Fig.
1 erforderliche Kraft kann in sehr einfacher Weise durch die
Centrigalkraft des Bremshebels selbst erreicht werden; man braucht zu diesem Zwecke
nur den Hebelarm b hinreichend schwer zu machen. Es
kann übrigens hierzu auch eine Feder zur Anwendung kommen.
Man erhält auf diese Weise eine einseitig wirkende Kupplung, welche, in Fig.
2 Taf. 2 dargestellt, bei Antriebsmechanismen verwendbar ist. B stellt hierbei die Antriebsriemenscheibe dar, an
welcher der Drehbolzen des Bremshebels A befestigt ist.
C ist die Lasttrommel bezieh. ein Zahnrad oder eine
Riemenscheibe, welche die Bewegung gegen den Widerstand Q in der Pfeilrichtung weiter zu übertragen hat, jedoch in derselben Richtung der
Riemenscheibe B frei vorlaufen kann. D endlich ist die mit C
fest verbundene Bremsscheibe.
Fig.
3 bis 5 Taf. 2
zeigen die constructive Ausführung einer solchen rotirenden Differentialbremse, wie
sie von der Ottakringer Eisengieſserei und
Maschinenfabrik in Wien an einem Fallhammer mit 250k Fallgewicht zur Anwendung gebracht wurde. Der
Fallbär wurde mittels eines um die Spule C gelegten, am
Bolzen F befestigten Riemens gehoben. Beim Aufschlagen
des Fallbärs muſste die Spule C gegen die
Antriebsriemenscheibe B frei vorlaufen können. D ist die mit C in einem
Stücke gegossene Bremsscheibe. Der in der Riemenscheibe B gelagerte Bolzen A trägt einerseits den
Doppelhebel, an dessen Enden das Bremsband eingehängt ist, und andererseits den
Winkelhebel y, beide aufgekeilt; letzterer bewirkt
durch den Druck der an der Nabe der Riemenscheibe angeschraubten Feder x jene Spannung des Bremsbandes, welche erforderlich
ist, um die Steifigkeit des letzteren zu überwinden und dasselbe an der Bremsscheibe
anliegend zu erhalten. Durch Vorschieben des Stiftes p
mittels des Riegels o wird der Winkelhebel y in der dem Drucke der Feder x entgegengesetzten Richtung bewegt und dadurch im geeigneten Augenblicke
die Bremse gelöst. Letzteres ist beim Fallhammer nothwendig, um den Fallbär nach
erfolgtem Heben frei herabfallen lassen zu können. Wird der Riegel o zurückgezogen, so wird der Stift p vermöge der Wirkung der Feder x und der Centrifugalkraft des Bremshebels zurückgeschoben und die Bremse
wieder selbstthätig wirksam. Der Riegel o ist in der
durch den flachen Deckel q bedeckten Nuth der
Riemenscheibennabe geführt und wird durch einen in die Ringnuth des mitrotirenden
Muffes L eingreifenden Hebel vorgeschoben und
zurückgezogen. Bemerkt mag noch werden, daſs hier sowohl die Spule C, als auch die Riemenscheibe B und der Muff L auf der feststehenden Achse
E lose rotiren, letztere auf langen Büchsen
angebracht.
In Fig.
6 und 7 Taf. 2 ist
eine weitere Anwendung der sich selbstthätig spannenden Differential bremse in Form
einer Kupplung für Kraftmaschinen dargestellt, wie sie vom Verfasser als Ersatz für
die Sperrkegelkupplungen von Uhlhorn und Pouyer in Vorschlag gebracht wurde. Dampfmaschine,
Wasserrad und Turbine übertragen bei gemeinschaftlicher Wirkung ihre Kraft zunächst
gesondert auf je eine mit der zum schützenden Gehäuse ausgebildeten Scheibe B rotirenden Differentialbremse und diese treibt die
Bremsscheibe D um, welche auf der für alle Motoren
gemeinschaftlichen durchlaufenden Transmissionswelle C
aufgekeilt ist. Die Bewegungsübertragung erfolgt in der Pfeilrichtung nach Fig.
7. Wird die Welle C durch den anderen Motor
mit gröſserer Geschwindigkeit umgetrieben, so läuft die Bremsscheibe D unter dem Bremsbande frei vor. Hier ist das Lösen der
Differentialbremse nicht erforderlich und daher ein diesbezüglicher Mechanismus
überflüssig. Die zur
Ueberwindung der Steifigkeit des Bremsbandes erforderliche Kraft wird durch die
Feder x im Verein mit der Centrifugalkraft des
Bremshebels ausgeübt, y ist eine Verlängerung des am
Bolzen A drehbaren Bremshebels, auf welche die Feder
x drückt. Die Scheibe B ist zur Ausbalancirung bei G mit einem
Gegengewichte versehen; sie ist auf die hohle Welle W
aufgekeilt, welche zweckmäſsig in zwei Lagern L ruht
(wovon in Fig. 6 nur
das an B anschlieſsende gezeichnet ist) und zwischen
diesen das die Kraft des Motors einleitende Zwischenglied, Zahnrad oder
Riemenscheibe, trägt. Die hohle Welle W, durch welche
die Transmissionswelle C frei drehbar hindurch geht,
bietet so gelagert letzterer zugleich an den Stellen der Kraftaufnahme erwünschte
Stützung und erhöht demnach die Solidität der ganzen Transmissionsanlage. In Fig.
7 ist der Schutzdeckel K abgehoben. – Eine
solche einseitig wirkende Reibungskupplung hat der von Uhlhorn und jener von Pouyer gegenüber den
groſsen Vortheil, daſs sie fast augenblicklich wirkt, daſs nämlich die Scheibe B durch die rotirende Differentialbremse sofort wieder
den Antrieb der Scheibe D und somit der Welle C übernimmt, sobald D in
der Bewegungsrichtung gegen B zurückbleiben will. Es
treten demnach hier nicht jene Stöſse ein, welche bei den genannten
Sperrkegelkupplungen, die erst nach ¼ oder ⅙ Drehung einklinken, unvermeidlich sind
und so häufig Brüche herbeiführen, welche eine Betriebsstörung im Gefolge haben.
Die Differentialbremse, für welche \frac{b}{a}>e^{f\alpha} ist,
erfordert, als rotirende angewendet, eine besondere Vorrichtung, welche die
Verstärkung der Bremsbandspannungen bei zunehmender Bremslast bewirkt und demnach
durch die Einwirkung der letzteren bethätigt wird. Fig. 8 und
9 Taf. 2 zeigen die constructive Durchführung einer solchen rotirenden
Differentialbremse, wie sie von der Maschinenfabrik E.
Becker in Berlin (* D. R. P. Nr. 5801 vom 29. November 1878) in Vorschlag
gebracht wurde, a ist die treibende Welle; auf
derselben sitzt lose der Arm b, an welchem der
Drehbolzen c des Bremshebels d befestigt ist. Die Bremsscheibe e ist auf
die getriebene Welle f und die Kurbel g auf die treibende Welle a aufgekeilt. Die Kurbel g greift mit dem
Kurbelzapfen in ein Langloch des Bremshebels d ein.
Rotirt nun die Kurbel g im Sinne des Pfeiles Fig.
8, so wird zunächst der Bremshebel d so weit
um c gedreht, bis die Bremse festgezogen ist, wonach
diese die Bremsscheibe e und somit die Welle f mitnimmt. Eine Steigerung der durch die Kurbel g übertragenen Kraft bringt sofort eine Vergröſserung
der Bremsbandspannungen hervor, indem ja die Kraftübertragung zunächst durch den
Bremshebel d selbst erfolgt. Die geschlossene Kupplung
läſst sich lösen, indem entweder der treibenden Welle a
gegen die getriebene f eine plötzliche verzögerte, also
relativ eine geringe rückläufige Bewegung gegeben wird, oder indem der getriebenen Welle durch eine
andere Kraft eine gröſsere Geschwindigkeit ertheilt wird, als die treibende bedingt,
oder endlich dadurch, daſs der Arm b der Kurbel g durch eine besondere Vorrichtung genähert wird.
Ein Beispiel einer solchen Vorrichtung zeigen Fig. 8 und
9. Der Arm b1, welcher mit b in einem Stücke hergestellt
ist, enthält das Muttergewinde für die Schraube h und
auf letzterer befindet sich einerseits ein Wulsträdchen aufgekeilt, andererseits
drehbar damit verbunden ein Keil, der sich zwischen b1, und der rückwärtigen Verlängerung der
Kurbel g einschiebt. Das Wulsträdchen läuft in dem
freien Räume zwischen zwei Scheiben l, die gemeinsam
oder getrennt eine Verschiebung in der Richtung der Wellenachse erfahren können.
Durch Annäherung der einen oder der anderen der beiden Scheiben l bis zur Anlage an das Wulsträdchen wird dieses in
Folge der Reibung in der einen oder in der entgegengesetzten Richtung umgedreht,
somit die Schraube h gegen das Wellenmittel verstellt.
Ist hiermit der Keil zwischen b1 und g so weit
eingeschoben, daſs b und g
einander genähert werden, so tritt eine Lösung der Bremse ein, die jederzeit durch
Drehung des Wulsträdchens im anderen Sinne wieder aufgehoben werden kann.
E. Becker bringt die vorgenannte Kupplung mit rotirender
Differentialbremse mit Hinweglassung einer besonderen Lösungsvorrichtung auch bei
Winden und Erahnen zur Anwendung. Fig. 10 und
11 Taf. 2 zeigen die Ausführung einer solchen einfachen Kupplung und Fig.
12 und 13 ihre
Anwendung als Kupplung und Bremsvorrichtung bei einer gewöhnlichen Bauwinde. Sie
sitzt auf der Vorgelegewelle, auf welcher auch die Kurbel g aufgekeilt ist. Durch Vorwärtsdrehen der Handkurbel wird auch die Kurbel
g vorwärts bewegt und somit die Bremse angezogen
derart, daſs bei weiterer Drehung der Handkurbel die Last gehoben wird. An der
verlängerten Nabenhülse des Armes b ist nun ein
Sperrrad vorhanden, in das ein Sperrkegel eingreifen kann, dessen Drehbolzen am
Windenständer befestigt ist, wie in Fig. 12
ersichtlich. Wird letzterer in das Sperrrad eingelegt, so bleibt die Last beim
Loslassen der Handkurbel ruhig hängen, weil sie selbst das Bremsband spannt. Wird
jedoch auf die Handkurbel ein Druck ausgeübt, entgegengesetzt demjenigen, welcher
zur Hebung der Last erforderlich ist, so werden die beiden Theile b und g einander genähert
und die Last sinkt mehr oder weniger gebremst nieder. In dieser Form der Anwendung
bietet die Kupplung noch den besonderen Vortheil, daſs während des Niederganges der
Last die Vorgelegewelle mit ihren Kurbeln still steht, womit eine groſse Gefahr für
den Arbeiter vermieden ist; ferner daſs die Last gebremst zum Stillstand gelangt,
wenn der Arbeiter bei eingelegtem Sperrkegel die Kurbel ganz frei läſst.
Im Hinblick auf die eingangs genannten Eigenschaften der Differentialbremse erscheint
diese, wie durch die vorgeführten Beispiele erläutert, als rotirende Differentialbremse ausgeführt, zur Herstellung von einseitig wirkenden Kupplungen besonders geeignet und
dürfte sie auſser in den hier vorgeführten noch in manchen anderen Fällen mit
Vortheil zur Anwendung gebracht werden können.
Tafeln