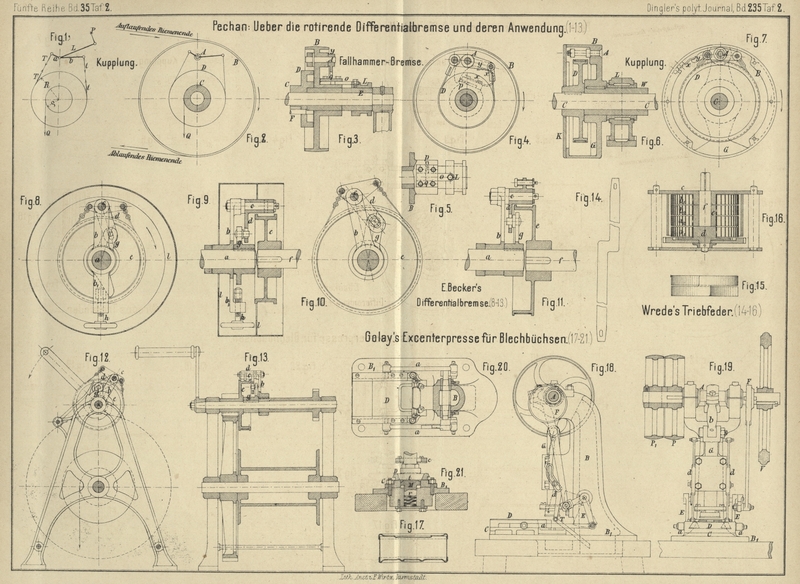| Titel: | Fr. Wrede's zusammengesetzte Triebfeder. |
| Autor: | H–s. |
| Fundstelle: | Band 235, Jahrgang 1880, S. 15 |
| Download: | XML |
Fr. Wrede's zusammengesetzte Triebfeder.
Mit Abbildungen auf Tafel 2.
Wredes's zusammengesetzte Triebfeder.
Die Spiralfedern wurden bisher nur nach einer Richtung gewickelt, wobei die
Vergröſserung der Blattlänge naturgemäſs eine Vergröſserung des Durchmessers der
Feder, also eine Erweiterung des Federgehäuses bedingte. Eine zweckmäſsige
Abweichung hiervon läſst die Doppelspiralfeder von Fr.
Wrede in Duisburg (* D. R. P. Nr. 5088 vom 29.
September 1878) zu, deren in der Mitte abgekröpftes Blatt (Fig. 14
Taf. 2) sich in zwei neben einander liegende, nach entgegengesetzten Richtungen
gewundene Spiralen (Fig. 15)
bringen läſst. Beide Enden der hierdurch erzeugten Doppelspiralfeder liegen demnach
innen – ein Umstand, der in so fern von Wichtigkeit ist, als er die Kupplung
mehrerer neben einander liegender Federn erlaubt, welche dann zusammen dieselbe
Abwicklung ergeben wie ein einziges Federblatt, dessen Länge der Summe der Längen
aller gekuppelten Spiralen gleichkommt. Die Kupplung erfolgt durch lose Büchsen auf
dem Federstift.
Als Beispiel ist die durch Fig. 16
Taf. 2 veranschaulichte Verbindung zweier Doppelspiralfedern angeführt. An dem
Schild c eines Federgehäuses, welches dem Federstift
f zur Lagerung dient, ist das Ende der einen Hälfte
b1 einer
Doppelspiralfeder befestigt, während das Ende der anderen Hälfte b2 an der lose auf dem
Federstift sitzenden Büchse e hängt. Die neben b2 liegende Hälfte a2 der zweiten
Doppelfeder ist gleichfalls mit der losen Büchse e
verbunden, das Ende der anderen Hälfte a1 dagegen an dem Stück d befestigt, welches mit dem Federstift, einer Sperrvorrichtung und einem
beliebigen Triebwerk in Verbindung steht. Die Federhälften a1 und b2 müssen links, die Hälften a2 und b1 rechts gewunden sein, wenn das ganze System durch
Drehung seiner Achse f von links nach rechts gespannt
werden soll. Bei der Abwicklung werden sich die zuerst entlasteten Federtheile an
die das ganze System umhüllende Trommel anlegen, welche, damit sie der Federbewegung
folgen kann, lose angeordnet werden muſs. Auf gleiche Weise können bei Anwendung
mehrerer loser Büchsen beliebig viele Federn mit einander gekuppelt werden und die
Abwicklungslänge läſst sich demnach nach Bedürfniſs erhöhen, ohne daſs man nöthig
hätte, zu oft unbequemen Gehäusedurchmessern zu greifen.
Als Hauptvortheil seines mehrfachen Federsystemes bezeichnet der Erfinder die
Ersparung von Uebersetzungsrädern, die durch Vergröſserung der Abwicklung ermöglicht
ist und welche überdies eine Verminderung der Zahn- und Zapfenreibung zur Folge
hat.
H–s.
Tafeln