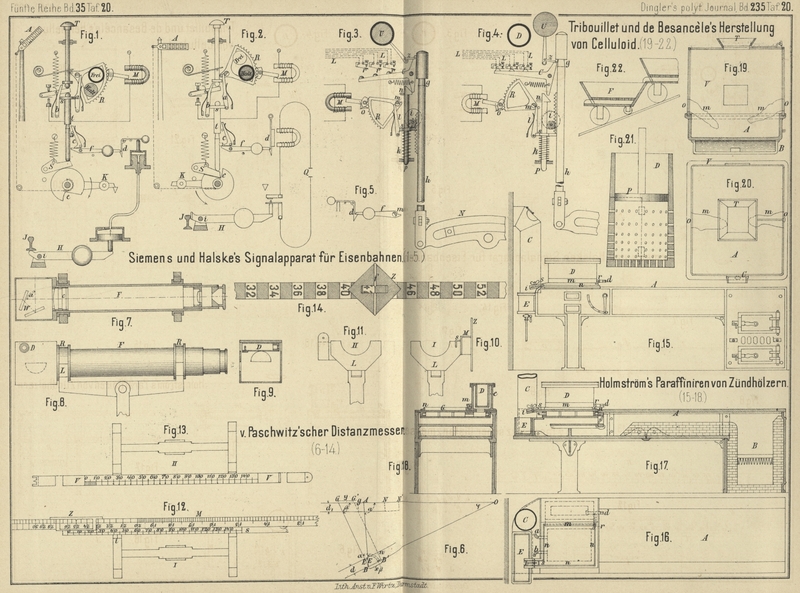| Titel: | Ueber die Herstellung von Celludoïd. |
| Fundstelle: | Band 235, Jahrgang 1880, S. 203 |
| Download: | XML |
Ueber die Herstellung von Celludoïd.
Mit Abbildungen auf Tafel 20.
Ueber die Herstellung von Celluloïd.
Zur Herstellung der Nitrocellulose-Kamphermasse, genannt Celluloïd, werden nach dem
Vorschlage von V. Tribouillet und L. A. de Besancèle in Paris (* D. R. P. Nr. 6828 vom 7.
Januar 1879) die Rohstoffe (Papier, Baumwolle, Leinen, Hanf, weiſse Holzsorten u.
dgl.) bei 100° getrocknet, in passender Weise gemahlen und dann nitrirt. Letzteres
geschieht in 15 bis 20cm hohen Behältern A (Fig. 19 und
20 Taf. 20) aus Glas, Thon oder glasurtem Eisenblech, welche auf einem
Untersatze B ruhen, durch welchen Wasser flieſst, um
den Boden des Behälters A kühl zu erhalten. Auf jedem
Behälter steht ein gläserner Aufsatz V, um den Arbeiter
gegen die entwickelten Dämpfe zu schützen; der in der Decke befindliche Trichter T kann durch Schieber geschlossen werden, die seitlich
angebrachte Oeffnung C aber durch eine Klappe. Die
gemahlenen trockenen Stoffe werden nun mit einem Säuregemisch behandelt, welches in
einem zweiten Behälter schon einmal benutzt war. Um die Mischung ausführen zu
können, steckt der Arbeiter seine Arme durch die gegenüber liegenden Oeffnungen o und die daran befestigten Gummiärmel m, welche den Arm bis zum Handgelenk umschlieſsen. Ist
nun die Masse 10 bis 15 Minuten mittels einer Art Kelle gut umgerührt worden, so
wird sie herausgenommen und in einer Presse D (Fig.
21) aus glasurtem Guſseisen, deren Boden und Wandungen fein durchlöchert
sind, durch Niederdrücken des Stempels P abgepreſst.
Die erhaltene kuchenförmige Masse kommt nun in den zweiten Mischungsbehälter und
wird hier in entsprechender Weise mit einem Gemisch von 3 Th. Schwefelsäure von
1,834 sp. G. und 2 Th. concentrirter Salpetersäure, in welchem noch Salpetrigsäure
gelöst ist, behandelt, dann in derselben Weise abgepreſst. Die abflieſsende Säure
kommt in den ersten Mischungsbehälter, um hier mit neuer Cellulose gemischt zu
werden, wie eben angegeben wurde. Um sie zu verstärken, kann man sie mit
concentrirter Schwefelsäure oder trocknem Natriumsulfat mischen.
Die ausgepreſste Nitrocellulose wird nun mit Wasser angerührt, dann in hölzernen
Gefäſsen mit doppeltem Boden F (Fig. 22
Taf. 20) gebracht, welche mit ungleich groſsen Rädern auf einer schiefen Ebene nach
und nach hinaufgeschoben werden, während das Waschwasser aus einem Behälter in den
andern herunterflieſst. Der Rest der Säure wird mittels Wasser ausgewaschen, welches
etwas Soda oder Ammoniak enthält, dann wird nochmals mit Wasser nachgewaschen.
Die für die Behandlung der Cellulose nicht mehr zu verwendenden
Säuren können verschiedenartig verwerthet werden und beispielsweise zur Darstellung
von Schwefelsäure dienen. Das zum Auswaschen benutzte Wasser kann in der Fabrikation
von Oxalsäure, Dextrin, zum Beizen u.s.w. Verwendung finden. Auch kann man die
Säuren durch kohlensauren Kalk sättigen, die löslichen salpetersauren Verbindungen
sammeln und dieselben mit denen reinigen, welche von dem Auswaschen des Sulfates
stammen, um sie einzudampfen und in der Industrie zu verwerthen, oder die
salpetersauren Verbindungen mit schwefelsaurem Kali oder Natron behandeln, wodurch
salpetersaure Salze entstehen, welche durch Eindampfen und Krystallisirenlassen in
den festen Zustand übergeführt werden können.
Das so erhaltene Pyroxyl wird bis zum weiteren Gebrauch unter Wasser aufbewahrt, dann
entsprechend getrocknet. Zur Herstellung durchscheinender und durchsichtiger Sachen
wird es mit entsprechenden Lösungsmitteln behandelt, die dann wieder abdestillirt
werden, so daſs man die in Teigform erhaltene Masse formen und vollkommen trocknen
kann. Für Elfenbeinnachahmungen und dergleichen undurchsichtige Gegenstände wird
Kampfer verwendet, der unter Hinzufügung von Wasser zerkleinert wird. (Vgl. 1877 224 341. 661. 225
520.) 100 Th. Pyroxyl werden mit 42 bis 50 Th. Kampfer innig gemischt, mit einem
sehr widerstandsfähigen Gewebe umgeben und dann in einem Haarpreſsbeutel zwischen
die Preſsplatten der Warmpresse gebracht. In die hohlen Wände der von einem
Blechmantel umgebenen Presse wird Dampf eingelassen; dieselbe ist mit einer Kammer
verbunden, in welcher Wasser niederrieselt, um die beim Pressen entweichenden Dämpfe
zu verdichten. Nach einer oder mehreren Stunden können die in den Preſstüchern
bleibenden Kuchen in eine angeheizte Cylinderpresse und dann in einen etwa 3cbm fassenden Apparat gebracht werden, in welchem
zur Aufnahme des Wasserdampfes Chlorcalcium oder Schwefelsäure aufgestellt wurde.
Der Apparat wird nach der Füllung mittels einer Luftpumpe luftleer gemacht, um die
Trocknung zu beschleunigen. Die so erhaltenen dünnen Platten werden dann in
bekannter Weise weiter verarbeitet.
Die Nichtentzündbarkeit des Pyroxyleïns soll dadurch erzielt werden, daſs man das
Pyroxyl in einer Lösung von kieselsaurem Natron auswäscht und dann phosphorsaures
Ammoniak oder Natron, borsaures Bleioxyd oder endlich die schmelzbarsten
Fluſsmittel, welche in der Porzellan- oder Glasmalerei angewendet werden,
hineinbringt.
Zur Herstellung künstlicher Gaumenplatten aus Celluloïd
gaben H. Hamecher und C.
Gebell in Berlin (* D. R. P. Nr. 6927 vom 21. Februar 1879) eine Cuvette
für Zahnärzte an, welche durch eine directe Flamme erhitzt werden soll, sonst aber
nichts besonderes bietet. Einen anderen entsprechenden Apparat hat J. H. Gartrell in Penzance, England (* D. R. P. Nr.
4007 vom 11. April 1878 und Zusatz Nr. 7380 vom 11. April 1879) in Vorschlag
gebracht.
Tafeln