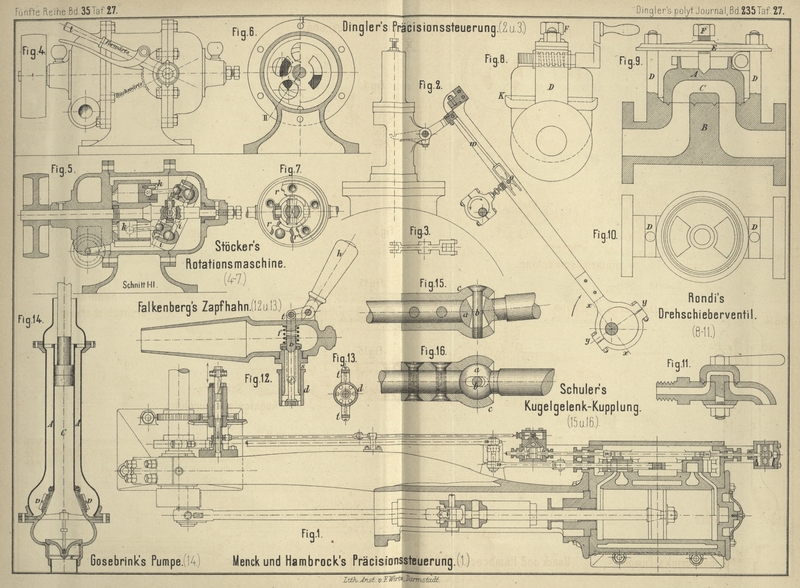| Titel: | Rotationsmaschine von J. Stöcker in Luzern. |
| Autor: | G. H. |
| Fundstelle: | Band 235, Jahrgang 1880, S. 256 |
| Download: | XML |
Rotationsmaschine von J. Stöcker in
Luzern.
Mit Abbildungen auf Tafel 27.
Stöcker's Rotationsmaschine.
Diese Maschine ist als regulirbarer Wassermotor oder als Pumpe sowie als
Dampfmaschine gleich gut verwendbar und verdient bei dieser Construction die
äuſserst sinnreiche Umsetzung der geradlinigen Kolbenbewegung in eine rotirende,
sowie die einfache Regulirung der Steuerung hervorgehoben zu werden. Fig. 4 bis
7 Taf. 27 stellen die Maschine nach dem Schweizerischen
Gewerbeblatt, 1879 S. 304 in Ansicht, Längsschnitt
und zwei Querschnitten dar.
Die motorische Kraft wirkt abwechselnd auf die fünf in einem gemeinsamen Gehäuse
vereinigten und mit der Antriebwelle rotirenden Kolben k der Arbeitscylinder und wird mittels Kugelgelenken an einen Ring r übertragen. Letzterer ist auf der Antriebwelle
mittels eines Universalgelenkes befestigt und erhält durch das abwechselnde Spiel
der fünf Kolben eine schaukelnde Bewegung; dieselbe kann der Ring jedoch nicht frei
ausüben, da ihn der in schiefer Lage festgestellte Teller i daran hindert. Vielmehr muſs sich der Ring r, um dem Einflüsse eines auswärts gehenden Kolbens – beispielsweise des
in Fig. 5 unten stehenden – zu folgen, gegen den oberen weiter abstehenden
Theil des Tellers i bewegen und wird auf diese Art,
indem ein Kolben nach dem andern in gleicher Weise zur Wirkung kommt, in
ununterbrochene Drehung versetzt. Um dabei möglichst wenig Reibungsverlust zu
verursachen, sind zwischen dem Ring r und dem Teller
i Stahlkugeln eingelegt.
Die Steuerung geschieht durch zwei Schlitze in der gemeinsamen Hinterwand des
Cylinderkörpers, welche auf dem Boden des Gehäuses wie ein Drehschieber
arbeiten.
Wird der Teller i durch den Umkehrhebel t in eine normale Lage zur Achse gebracht, so ist auch
die Kolbenkraft normal zum Teller und zur Kugelbahn gerichtet, so daſs keine
Bewegung der Maschine erfolgen kann. Dreht man nun den Hebel t in gleichem Sinne weiter, bringt also jetzt den Teller i in eine entgegengesetzte Lage zur ursprünglichen, so
wird die Kolbenkraft offenbar eine Abwärtsbewegung der Kugeln und eine Drehung des
Ringes r nach der entgegengesetzten Richtung
hervorrufen, die Maschine läuft dann rückwärts.
G. H.
Tafeln