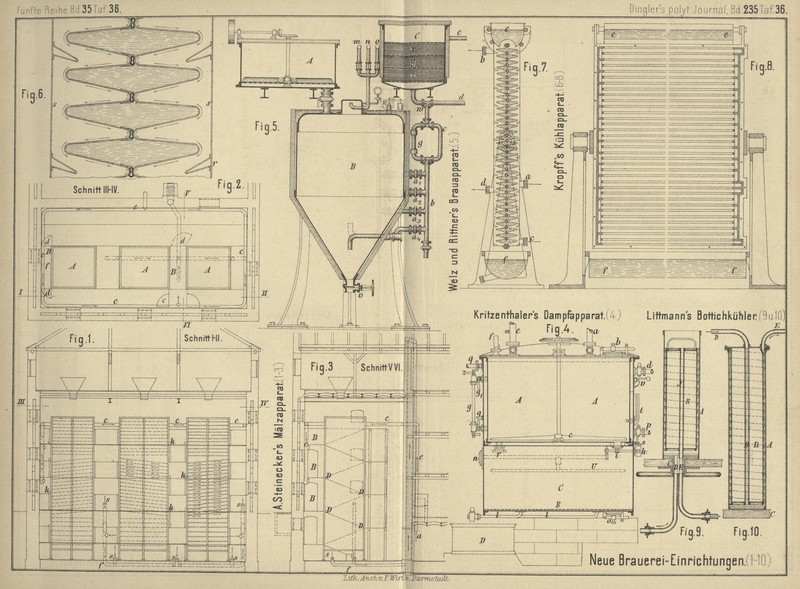| Titel: | Ueber neue Brauerei-Einrichtungen. |
| Fundstelle: | Band 235, Jahrgang 1880, S. 358 |
| Download: | XML |
Ueber neue Brauerei-Einrichtungen.
(Fortsetzung des Berichtes Bd. 233 S.
215.)
Mit Abbildungen auf Tafel 36.
Ueber neue Brauereieinrichtungen.
Mälzapparat. Um die ruhende Luftschicht zwischen den 28
bis 40 über einander liegenden Horden seines Keimapparates in Bewegung zu bringen,
legt A. Steinecker in Freising, Bayern (* D. R. P. Nr.
7133 vom 22. Januar 1879) diese wellenförmigen Horden theils horizontal, theils
schief (Fig. 1 bis
3 Taf. 36). Um die frische Luftströmung zu begünstigen, wird der Raum, in
welchen die Keimapparate aufgestellt sind, dadurch gelüftet, daſs in eine geeignete
Thonröhrenleitung e bei a
(Fig. 3) Luft eingeführt wird, welche in die Räume B tritt; diese werden einerseits durch die Seiten von zwei Keimapparaten
die Thüren c und d
begrenzt und oben offen gelassen, während sie unten durch die Klappen k an den schrägen Etagenfuſsböden D in verschiedener Höhe abgeschlossen werden können.
Gleichzeitig können auch einzelne Horden durch vorgehängte bewegliche Blechklappen
mehr oder weniger vom Luftzuge abgesondert werden. Die Kohlensäure haltige Luft wird
am Boden und an den Seiten in geringer Höhe von s aus
durch die Röhren f abgesaugt, welche mit einem
Schornstein verbunden sind.
Brauerei-Dampfapparat von F.
Kritzenthaler in Bayreuth (* D. R. P. Nr. 7367 vom 23. Februar 1879). In
dem Maisch- und Kochraum A (Fig. 4 Taf.
36), welcher von einem mit Sicherheitsventil v
versehenem Dampfventil umgeben ist, wird durch den Wasserhahn a die dem geschrotenen Malz entsprechende Menge Wasser
eingelassen, dann das Malz durch das Mannloch b
eingeschüttet und mittels des Rührflügels c eingeteigt.
Nun läſst man durch den Hahn d Dampf in den Dampfraum
einströmen und erwärmt das Gemisch, bis das Thermometer t 35° anzeigt. Unter fortwährendem Rühren erwärmt man nach einiger Zeit
durch weiteres Dampfeinlassen auf 46°, dann auf 62°. Nun schlieſst man den
Mannlochdeckel b luftdicht ab, öffnet den Hahn e, welcher zu einer Luftpumpe führt, läſst durch den
Hahn d Dampf ein und pumpt, bis das Vacuummeter f nur noch 0at,373
zeigt, so daſs das Gemisch bei 75° kocht. Das gebildete Condensationswasser wird
zeitweilig durch den Hahn s abgelassen.
Um zu sehen, ob die Maische genügend gekocht ist, öffnet man die beiden mit dem
Flüssigkeitstandanzeiger g und dem Maischraum A in Verbindung stehenden Hähne g1 und g2, wobei sich die Maische im Glasrohr mit der
inneren Flüssigkeit gleichstellt, schlieſst diese Hähne wieder und beobachtet die
Zertheilung der Maische. Genügt das Kochen noch nicht, so schlieſst man den oberen
mit dem Maischraum in Verbindung stehenden Hahn g1 und öffnet das obere Lufthähnchen z sowie das untere mit dem Maischraum in Verbindung
stehende Hähnchen g2,
worauf sich die im Glasrohr befindliche Maische zurückzieht, und kann man diesen
Versuch so lange fortsetzen, bis sich die Maische vollständig klärt. Ist dieses Ziel
erreicht, so öffnet man das Ventil i, indem man den
Hebel des Gewichtes h, welcher vierkantig auf die Welle
aufgepaſst ist, mit dem Gewicht hinwegzieht und die ganze Maische in den unteren mit
einem Senkboden R versehenen Raum C und von da durch die beiden Röhren l in den Grand D ablaufen
läſst.
Mittlerweile öffnet man das Mannloch b und reinigt den
Kochraum A; das Spülwasser wird mittels Rinne durch die
Verschraubung r und das Mannloch n ausgelassen, wonach man dann mittels einer Pumpe
durch den Hahn m (welcher vor dem Hahne e sich befindet) die Maische aus dem Grand D in den Kochraum A
bringt, den Hopfen zusetzt, den Dampfhahn d öffnet und
unter dem gewöhnlichen atmosphärischen Luftdruck bei geöffnetem Mannloch b die Würze kocht.
Während im Raum C das sogen. Ueberschwänzwasser durch
einen im Innern befestigten, durch das Mannloch einleg- und entfernbaren
Ueberschwänzer U eingebracht wird, öffnet man nach
vollständiger Entfernung des Nachgusses die Oeffnung o,
hebt ein Stück Senkboden aus und entfernt die Treber, hebt schlieſslich den übrigen
Senkboden aus und reinigt gleichzeitig den Raum C. Nach
Verschluſs der Oeffnung
o und Einlegung des Senkbodens kann die genügend
gekochte Würze wieder durch das Ventil i in den Raum
C abgelassen werden, während der Hopfen bei
Oeffnung der Hähne und der Röhren l durch den Senkboden
zurückgehalten wird, so daſs nach geschehener Reinigung die Würze wieder zum
Abkühlen in den Raum A gebracht werden kann. Diesmal
wird der Hahn p geöffnet, durch welchen man Eiswasser
oder auch durch eine Kaltluftmaschine abgekühlte Luft in den Raum B ein- und durch den Hahn q ausströmen läſst. Ist die Würze genügend abgekühlt, so kann dieselbe zur
weiteren Behandlung durch die Verschraubung r, an
welche ein durch das Mannloch n gehender Schlauch
angeschraubt wird, abgelassen werden.
Bierbrauverfahren. Nach E.
Welz in Breslau und A. Rittner in Schweidnitz
(* D. R. P. Nr. 7736 vom 13. Mai 1879) wird das fein gemahlene Malzschrot mit Wasser
eingeteigt und in bekannter Weise gemaischt. Dann wird die Maische langsam auf das
mit Siebboden versehene Vorfilter A (Fig. 5 Taf.
36) gepumpt. Unter fortwährendem Rühren flieſst die trübe Flüssigkeit durch ein Sieb
in das mit Sicherheitsventil und Manometer versehene Klärgefäſs B. Die zurückbleibenden Hülsen werden mit heiſsem
Wasser gewaschen, die Waschflüssigkeit wird ebenfalls in das Klärgefäſs B abgelassen. Die Maische bleibt nun zur Verzuckerung
unter hohem Druck stehen, welcher von den drei Röhren m,
n und o aus durch gespannte Dämpfe, durch
Wasser- oder Luftdruck hergestellt werden soll. In Folge dieses Druckes klärt sich
die Flüssigkeit rasch, die trübenden Theile setzen sich schnell zu Boden und bilden
eine feste Ablagerung. Unter Erhaltung des Druckes wird die Flüssigkeit nun
allmählich durch die Hähne a1 bis a4 und
die Röhren b, c, g und d
nach der Braupfanne befördert. Sobald man durch das Glasrohr g bemerkt, daſs die Flüssigkeit trübe läuft, wird sie durch Stellung des
Dreiweghahnes w in das Nachfilter C getrieben, in welchem sich drei Kästen mit Siebböden
und durchlöcherten Decken befinden. Der untere Kasten z
ist mit Hopfendolden, der mittlere y mit losen Hülsen
aus dem Vorfilter, der obere Kasten x mit gepreſsten
Hülsen gefüllt. Die Flüssigkeit steigt in diesen Schichten auf und flieſst durch das
Rohr e zur Braupfanne ab. Die im Filter zurückbleibende
Würze wird durch heiſses Wasser nachgedrückt, während der im Klärgefäſs B gebliebene feste Bodensatz durch das Ventil v abgelassen wird. Die Würze wird nun in der Pfanne in
bekannter Weise mit Hopfen gekocht und durch das Hopfensieb wieder in das Klärgefäſs
B abgelassen. Hier wird die Flüssigkeit wieder
unter Druck geklärt, dann aufs Kühlschiff gebracht und in bekannter Weise weiter
behandelt.
Kühlapparat. O. Kropff jr. in Nordhausen (* D. R. P.
Nr. 7659) vom 29. Januar 1879) hat den bekannten Apparat von Neubecker (* 1876 222 490) dadurch verbessert, daſs er leicht aus einander
genommen werden kann. Zu diesem Zweck werden zwei an Seitenwänden befestigte
gewellte Bleche so gegen einander gedrückt, daſs sie Röhren von flachovalem
Querschnitt bilden (Fig. 6 bis
8 Taf. 36). Die Seitenwände sind den Röhrenquerschnitten entsprechend
durchbrochen, so daſs das Eiswasser von c bis d, das Brunnenwasser von a
bis b in Schlangenwindungen nach oben steigt. Die Würze
flieſst von der Vertheilungsrinne e aus auf beiden
äuſseren Seiten der Wellenbleche herunter, um sich in der Schale f zu sammeln. Soll der Apparat gereinigt werden, so
löst man die Schrauben ringsum, entfernt die eine Hälfte und bürstet den Schlamm ab.
Die Dichtung der wieder vereinigten Hälften geschieht mittels Gummischläuche, wie
der Schnitt Fig. 6
andeutet. Die seitlichen, mit Rippen r versehenen
Schutzbleche s sollen das Condensationswasser der Würze
wieder zuleiten.
E. Welz in Breslau und J.
Linz in Rawicz (* D. R. P. Nr. 7842 vom 14. Juni 1879) wollen einen
ringförmigen Oberflächen kühler anwenden, die Kühlung aber mittels eines
aufgeblasenen Luftstromes beschleunigen – ein Vorschlag, welcher keineswegs
empfehlenswerth erscheint.
Kühlapparat für Gährbottiche. F. Littmann in Halle a.
S. (* D. R. P. Zusatz Nr. 7916 vom 29. Mai 1879) will zur bessern Ausnutzung des
Kühlwassers um das Abfluſsrohr J (Fig. 9 Taf.
36) einen auſsen mit einer genau in den Cylinder A
passenden Blechspirale versehenen Cylinder R anwenden.
Das unten bei D eintretende Kühlwasser steigt in dieser
Spirale langsam auf und flieſst bei E wieder ab. Der
Kühler wird in bekannter Weise im Boden C des
Kühlbottiches befestigt, oder er wird, wie Fig. 10
zeigt, in den Bottich hineingesetzt, dann aber oben geschlossen.
Tafeln