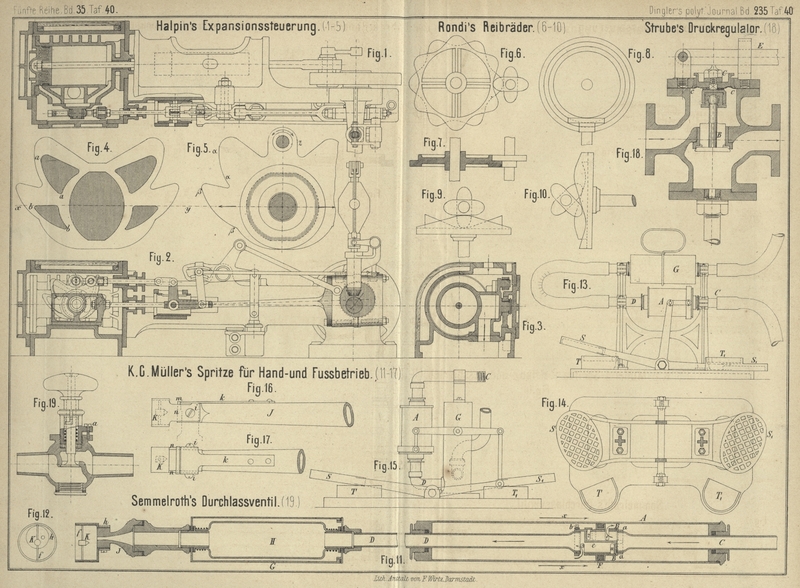| Titel: | Expansionssteuerung von Druitt Halpin in London. |
| Autor: | M-M. |
| Fundstelle: | Band 235, Jahrgang 1880, S. 409 |
| Download: | XML |
Expansionssteuerung von Druitt Halpin in
London.
Mit Abbildungen auf Tafel 40.
Halpin's Expansionssteuerung.
Als Dampfvertheilungsorgan dient ein eigenthümlich geformter Flach Schieber, als
Bewegungsmechanismus ein mit normalem Voreilen aufgekeiltes Excenter und die Halpin'sche Steuerung (Fig. 1 bis
5 Taf. 40) gehört somit, ungeachtet ihres complicirten Ansehens, zu den
positiven Steuerungen mit oscillirender Bewegung eines einzigen
Dampfvertheilungsorgans. Aber der Schieber ist derart geformt, daſs die
Einströmungskanten, unabhängig von der die Ausströmung besorgenden Schiebermuschel,
eine besondere Bewegung annehmen können, und die Excenterbewegung gelangt, nach zwei
verschiedenen Richtungen zerlegt, auf die Steuerung zur Einwirkung, so daſs dieselbe
Wirkung erzielt wird, als ob die Ausströmung von einem fixen Excenter, die
Einströmung dagegen mit besonderem Schieber durch ein mit variabler Voreilung vom
Regulator stellbares Excenter gesteuert würde.
Zu diesem Zwecke erhalten Schiebergesicht und Schieber die aus Fig. 4 und
5 ersichtliche Form; die mittlere nahezu kreisförmige Oeffnung des
Schiebergesichts Fig. 4
bildet die Ausströmung, ihr entspricht im Schieber (in Fig. 5 in
der Draufsicht gezeichnet) die punktirte Contur der Schiebermuschel und die
Bedienung der Ausströmung findet, sowie der Schieber in der Achse xy hin- und herbewegt wird, in gewöhnlicher Weise
statt. Wird nun gleichzeitig mit diesem geradläufigen Gang dem Schieber eine
oscillirende Bewegung um den Mittelpunkt des Schiebermuschelkreises ertheilt, so
wird selbstverständlich die Ausströmsteuerung nicht im geringsten beeinfluſst,
während die Einströmung in einfachster Weise hierdurch variabel gemacht wird. Denkt
man sich nämlich den Schieber in der Richtung von links nach rechts über das
Schiebergesicht geschoben, so wird nach Ueberschreiten der Mittelstellung zunächst
die rechte Kante der Schiebermuschel über die beiden zum rechten Cylinderende
führenden Fenster des Schiebergesichtes treten und so die Ausströmung dieses
Cylinderendes einleiten. Hierauf gelangen die Einströmkanten α und β des Schiebers über die entsprechenden
Kanten a und b der zum
linken Cylinderende führenden Einströmkanäle und eröffnen hier den Dampfzutritt.
Falls nun der Schieber
allein unter dem Einflüsse der geradlinigen Bewegung arbeiten könnte, würde nunmehr
der Einströmkanal immer weiter eröffnet und, entsprechend der geringen Voreilung des
Excenters, nahezu volle Füllung gegeben. Dies ist jedoch thatsächlich nicht der Fall
und der Schieber erhält, durch einen oberhalb der Schiebermuschel angebrachten
Zapfen z, eine nach rechts oder links gerichtete kleine
Verdrehung.
Findet nämlich, im Augenblicke des Oeffnens der linken Einströmkanäle, eine Drehung
des Schiebers nach rechts statt, so wird die Oeffnung beschleunigt und die Füllung
vermehrt, andererseits bei nach links gerichteter Drehung die Oeffnung verlangsamt,
die Füllung vermindert und zwar um so mehr, je gröſser der Verdrehungswinkel gewählt
wird, bis endlich der Kanal überhaupt nicht mehr geöffnet wird. Indem der Betrag der
Verdrehung von der Stellung des Regulators abhängig gemacht wird, ist die
selbstthätige Regulirung der Expansion leicht zu erzielen.
Die constructive Ausführung dieses geistreichen Gedankens ist in Fig. 1 bis
3 dargestellt. Der Schieber wird in einem concentrisch der
Schiebermuschel aufgesetzten Zapfen von dem Schieberrahmen erfaſst, welcher im
Schieberkasten passend geführt und von der Stange des Steuerexcenters in normaler
Weise bewegt wird. Ein zweiter oben befindlicher Zapfen z des Schiebers steht durch ein kurzes Gelenk mit einer zweiten
Schieberstange in Verbindung, welche die abwechselnde Drehbewegung des Schiebers
einleitet. Dieselbe ist nämlich auſserhalb des Schieberkastens mit einem Winkelhebel
verbunden, welcher in dem Verbindungsbolzen von Vertheilungsschieberstange und
Excenterstange gelagert ist und an seinem anderen Ende von einer Lenkerstange
erfaſst wird. So nimmt die obere Schieberstange einerseits an der hin- und
hergehenden Bewegung der unteren Schieberstange theil, empfängt jedoch auſserdem
noch eine relative Bewegung, welche die gewünschte Verdrehung des Schiebers
hervorruft. Zu diesem Zwecke ist die am unteren Ende des Winkelhebels angreifende
Lenkerstange auf und nieder zu bewegen, was dadurch geschieht, daſs dieselbe mit dem
einen Arme eines Hebelkreuzes verbunden ist, das durch eine besondere Excenterstange
von der Scheibe des Steuerexcenters angetrieben wird und gleichzeitig mit einem
dritten Hebelarme die Bewegung der Kesselspeisepumpe besorgt. Das im Maschinenbette
fix gelagerte Hebelkreuz hat constanten Ausschlag und die zum Winkelhebel führende
Lenkerstange erhält dadurch variablen Hub, daſs sie mittels des Regulators in einer
Coulissenbahn dem Drehpunkt des Hebelkreuzes mehr oder weniger genähert wird. Je
gröſser der Hub, desto geringer wird die Füllung und ist derart die Regulirung der
Expansion mit geringem Kraftaufwand zu besorgen.
Von Constructionseinzelheiten ist die einfache Form des Excenterbügels
bemerkenswerth, ferner die Plungerführung der Schieberstange im Angriffpunkt der
Exenterstange und endlich die eigenthümliche Construction des Dampfcylinders.
Derselbe ist aus zwei Theilen hergestellt, dem eigentlichen Cylinderkörper sammt dem
Schiebergesicht und dem Cylindermantel, welcher gleichzeitig den Schieberkasten
bildet; beide Theile sind gesondert an das Bett angeschraubt und nur durch das
Auströmrohr (Fig. 3) mit
einander verbunden. Zwischen Cylinder und Mantel streicht überall frischer
Kesseldampf hindurch und, um die Wärmeaufnahme zu vermehren, hat sowohl der
Cylinderkörper, als der hintere Deckel Rippen angegossen; der Kolben ist, wie aus
Fig. 2 ersichtlich, entsprechend ausgenommen. (Nach Engineering, 1879 Bd. 27 S. 481.)
M-M.
Tafeln