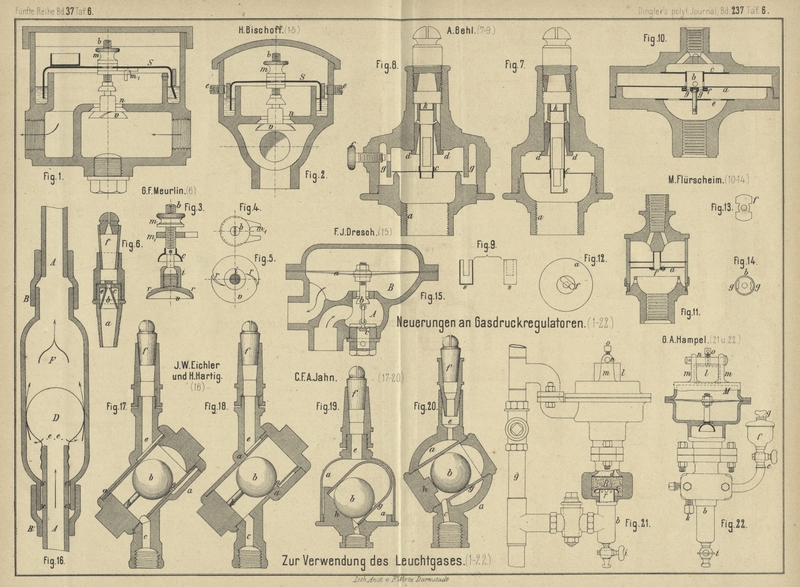| Titel: | Zur Herstellung und Verwendung von Leuchtgas. |
| Fundstelle: | Band 237, Jahrgang 1880, S. 44 |
| Download: | XML |
Zur Herstellung und Verwendung von
Leuchtgas.
(Fortsetzung des Berichtes S. 237 Bd.
236.)
Mit Abbildungen auf Tafel 6.
[Zur Herstellung und Verwendung von Leuchtgas.]
Gasregulator. Auch der Regulator von
H. Bischoff in Hamburg (* D. R. P. KL 26 Nr. 5598
vom 5. October 1878) ist als eine Abänderung des Judkin'schen zu betrachten. Wie
Längs- und Querschnitt Fig. 1 und
2 Taf. 6 zeigen, ist an dem zwischen den Spitzen e aufgehängten Schwimmer S das in Fig.
3 bis 5 in
vergröſsertem Maſsstabe gezeichnete Ventil v mittels
der Mutter m und der als Gegenmutter wirkenden Gabel
m1 und der Spindel
b gasdicht befestigt; letztere ist mittels
Kugelgelenk i mit dem Ventilteller v verbunden, so daſs dasselbe in jeder Lage der Spindel
b gleichmäſsig gegen die Dichtungsfläche des
Ventilsitzes n abschlieſsen kann, ohne ein Klemmen beim
Auftrieb des Schwimmers S zu veranlassen. Die an der
Spindel b befestigte Kappe c soll dazu dienen, das Kugelgelenk gegen herabfallende und vom Gase
mitgeführte Schmutztheile zu schützen. Die in der Dichtungsfläche des Ventiltellers
eingefeilten Rinnen r sollen bewirken, daſs bei
geschlossenem Ventil noch eine geringe Gasmenge zur Gasleitung gelangen kann. Der Quecksilberverschluſs
ist ebenfalls mit Glycerin bedeckt.
J. Rimanoczy in Berlin (D. R. P. Kl.
4 Nr. 5967 vom 13. October 1878) schlägt vor, in das nach dem Brenner führende
Gasrohr ein 2 bis 10mm langes Stück spanisches
Rohr einzuschieben, welches erst mit Wasser völlig ausgelaugt, dann mit Blauholz und
Eisenvitriol schwarz gefärbt ist. Da das Gas die Poren des Rohres durchdringen muſs,
so soll es ruhiger und gleichmäſsiger brennen als bisher, – bis eben die Poren
verstopft sind.
Bei dem selbstthätigen Regulator von G. F. Meurlin in
Stockholm (* D. R. P. Kl. 26 Nr. 4703 vom 27. August 1878) wird in die Gasröhre ein
conischer Fuſs a (Fig. 6 Taf.
6) eingeschraubt. Durch den Gasdruck wird die kleine conische Röhre b etwas gehoben, das Gas strömt theils durch die
Oeffnung in der Spitze, theils um b herum durch das
Loch der Scheibe e zum Brenner f. Nimmt der Gasdruck zu, so wird der Conus b
gehoben, bis der Druck des in der Kammer c befindlichen
Gases nebst dem Eigengewicht von b dem inneren
Gasdrucke das Gleichgewicht hält. Bei zu heftigem Gasdruck wird das Loch in der
Scheibe e durch die Spitze des Conus b völlig geschlossen, so daſs das Gas nur durch die
Spitze von e zum Brenner strömen kann. Läſst der Druck
nach, so sinkt der Conus b wieder.
Bei den selbstthatig regulirenden Gasbrennern von A. Behl in Quedlinburg (* D. R. P. Kl. 26 Nr. 4537 vom
19. Juli 1878) ist das Ventil c (Fig. 7 Taf.
6) ein aus schwachem Blech gefertigtes Röhrchen mit aufgelötheter Scheibe, durch
dessen Oeffnungen der innere Raum des Regulators mit seinem Gaszugang und dem
Brenner in Verbindung steht. In der durch Fig. 7
dargestellten Form hat das Ventil c unten einen
verstellbaren Schieber s (Fig. 9), um
den Gaszugang für den Brenner passend einstellen zu können; oder aber das Ventil ist
unten geschlossen und es tritt an die Stelle des verstellbaren Schiebers die
Regulirschraube f (Fig. 8) in
dem Umlaufkanal g, um die Regulirung von auſsen
zugänglich zu machen. Der Ventilsitz d ist ein kurzer,
nach oben etwas abgesetzter Cylinder mit Seitenöffnungen in der Gegend des Absatzes.
Derselbe ist der besseren Bearbeitung und Reinigung halber in seiner Längenrichtung
ganz durchbohrt und durch eine kleine eingedrückte Kappe k nach oben wieder geschlossen. Durch den verstellbaren Schieber s oder durch die Stellschraube f wird der Gaszugang für den anzuwendenden Brenner passend, d.h. so viel
geringer eingestellt, daſs der gröſsere Brennerquerschnitt in dem Raum über der
Scheibe des Ventiles c beim Brennen der Flamme eine so
groſse Druckentlastung erzeugt, daſs das Gewicht des Ventiles c durch den gröſseren Druck unter seiner Scheibe
gehoben wird. Alsdann schwebt das Ventil c und begrenzt
durch seine Höhenstellung den Gasausgang derart, daſs der vorerwähnte Druckunterschied, welcher von
dem Gewicht und den Druckflächen des Ventiles c
abhängig ist, constant erhalten wird. (Vgl. Grabham
1872 206 * 181).
M. Flürscheim in Gaggenau, Baden (*
D. R. P. Kl. 26 Zusatz Nr. 8105 vom 20. Juni 1879) hat seinen Gasregulator (1879 231*515) jetzt dahin verbessert, daſs der Schwimmer a (Fig. 10
Taf. 6) durch den Rohrabschnitt b in der Scheibe c und durch den Stift d in
der mit Löchern versehenen Scheibe e Führung hat. Der
den Gasverbrauch bestimmende Schieber f besteht bei den
Apparaten mit Glaswandung (Fig. 11 und
12 Taf. 6) aus einem einfachen, sich um einen seitlich von der
Mittelöffnung angebrachten Stift drehenden Blättchen; bei den gröſseren Regulatoren
ist der Schieber um den Führungsstift d drehbar und
liegt dicht am Schwimmer an. Je nachdem man ihn dreht, bewirkt er eine mehr oder
weniger groſse Oeffnung oder Schlieſsung der Oeffnungen g (Fig. 13 und
14), durch welche das Gas in den Rohrabschnitt b und von da in den Brenner gelangt.
Bei dem früher beschriebenen Membranregulator von F. J.
Dresch in Chemnitz (1879 231*515) hat sich der
Uebelstand gezeigt, daſs bei geringem Verbrauch durch den Gasdruck auf die
Ventilfläche der Apparat mangelhaft wirkte; durch die in Fig. 15
Taf. 6 dargestellte Construction soll dies nach dem Zusatzpatent (* D. R. P. Kl. 26
Nr. 6819 vom 5. October 1878) vermieden werden. Wenn sich der Gasdruck im
Regulatorgehäuse vergröſsert, so hebt sich die Membran a und mit ihr das Ventil b, wodurch die
Einströmungsöffnung kleiner wird. Mit dem Verringern der Ventilöffnung wird ein
Druckunterschied in den Räumen A und B eintreten, wodurch das Ventil von unten einen
stärkeren Gasdruck erleidet als von oben. Die Membran c
ist mit dem Ventil b fest verbunden und gleichflächig
mit ihm; der auf die Membran c ausgeübte Gasdruck zieht
das Ventil b ebenso stark nach unten, als dasselbe nach
oben gedrückt wird. Es ist auf diese Weise das Ventil b
von dem bei geringer Ventilöffnung auf ihm ruhenden unteren Gasdruck entlastet.
Die Membran soll dadurch haltbar gemacht werden, daſs man sie einfettet, mit echter
Silber- oder Goldbronze überzieht und dann durch Walzen glättet. (Vgl. Sugg 1875 217*106. Tieftrunk 1875 217*326. Elster 1874 214*130. Lacey 1874 214*434. Hirzel 1879 231*513.)
J. W. Eichler und H. Hartig
in Stuttgart (* D. R. P. Kl. 26 Nr. 5492 vom 6. November 1878) schalten in die
Gasleitung A (Fig. 16
Taf. 6) mittels der Gummischläuche B und Gummischnüre
c das erweiterte Glasgefäſs F ein. Das von der Hauptleitung kommende Leuchtgas tritt nun in den
Gummiballon D, geht durch die mittels einer feinen
Nadel gestochenen Löcher e zwischen Ballon- und
Glaswandung hindurch und
entweicht nach oben. – In wie weit es möglich sein wird, hiermit einen
gleichmäſsigen Gasverbrauch zu erzielen, steht dahin.
Der in Fig. 17 bis
20 Taf. 6 in verschiedenen Formen dargestellte trockne Regulator von C. F. A. Jahn in Zizkov bei Prag (* D. R. P. Kl. 26 Nr.
5601 vom 12. October 1878) besteht aus einem unter 45° geneigten Gehäuse a, dessen oberer Theil doppelwandig ist und einer im
Innern frei sich bewegenden Hohlkugel b. Die obere
Hälfte des äuſseren Theiles des Gehäuses hat einen um 6mm gröſseren inneren Durchmesser als der untere Theil, so daſs zwischen
dem inneren, durchweg gleich weiten Cylinder und dem äuſseren oben erweiterten
Gehäuse ein kreisförmiger Zwischenraum gebildet wird, von welchem der Ausgang e nach dem Brenner f
abzweigt. Gleichzeitig steht dieser Zwischenraum durch den 1mm breiten und 12mm langen Schlitz g mit dem inneren Cylinder
in Verbindung, in welchem sich die Hohlkugel befindet und auf dem Stifte h in dem Falle aufruht, als kein Gas durch den
Regulator strömt. Sobald das Gas durch den Eingang c in
den Regulator bezieh. in den inneren gleich weiten Hohlcylinder eintritt, wird die
Regulirungshohlkugel durch den Gasdruck auf der schiefen Ebene in die Höhe gerollt,
bis sie an dem Schlitze g anlangt und denselben unter
einem Gasdrucke von 20mm so weit deckt, daſs ein
bestimmter stündlicher Gasverbrauch der Flammen erreicht wird, welcher durch die
Weite des Schlitzes g und die Gröſse der Hohlkugel
geregelt wird.
Falls der Gasdruck den Normaldruck von 20mm
übersteigt, wird die Hohlkugel auf der innereninnneren schiefen Fläche höher getrieben und der Schlitz g immer mehr bezieh. in dem Maſse gedeckt, daſs der normale Gasverbrauch
des Brenners nur unbedeutend verändert wird. Bei Abnahme des Druckes rollt die
Hohlkugel auf der schiefen Hohlfläche des inneren Cylinders zurück und öffnet somit
den Schlitz um etwas, so daſs der normale Gasverbrauch wieder erreicht wird.
Der mit Reinigungsapparat verbundene Regulator von G. A. Hampel in Chemnitz (* D. R. P. Kl. 26 Nr. 6026
vom 15. October 1878) läſst sich mittels eines oder zweier Hähne aus der Gasleitung
g (Fig. 21 und
22 Taf. 6) ausschalten. Das von dem Rohre b
aus in die Reinigungskammer R eintretende Gas wird
durch den Deckel c gezwungen, sich in der von dem
Drahtsiebe d bedeckten Schafwolle zu verbreiten. Es
wird ferner täglich der kleine Behälter f mit
Steinkohlennaphta gefüllt, welche man Abends durch Oeffnen der Hähne e und g in den Raum R flieſsen läſst, damit es denselben bis zur Mündung
des Rohres r anfüllt. Die sich ansammelnden
Flüssigkeiten können durch die Hähne k und i abgelassen werden.
Zum Schutz der Verbindungsöffnung des über der Membran befindlichen Raumes M mit der Atmosphäre steht über derselben, durch eine Lederscheibe
abgedichtet, die guſseiserne Kapsel l zwischen den
beiden Ständern m, durch welche der Bolzen n gesteckt ist, der durch ein Schloſs am Herausziehen
verhindert wird und mittels der Schraube o die Kapsel
festhält. Das Luftloch befindet sich im obern Deckel der Kapsel Z, wo die Schraube aufsitzt, welche ihrer Länge nach
bis zu dem Loch, wo der Schlüssel eingesteckt wird, durchbohrt ist.
Tafeln