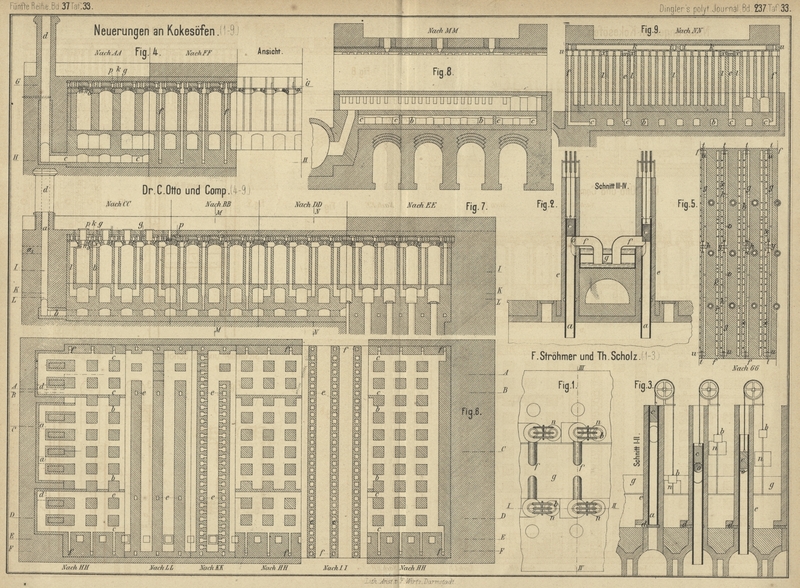| Titel: | Ueber Neuerungen an Kokesöfen. (Patentklasse 10.) |
| Fundstelle: | Band 237, Jahrgang 1880, S. 385 |
| Download: | XML |
Ueber Neuerungen an Kokesöfen. (Patentklasse
10.)
Mit Abbildungen auf Tafel 33.
Neuerungen an Kokesöfen.
Um die bei der Herstellung von Kokes gebildeten und bisher meist
verloren gehenden Producte, namentlich das Ammoniak und den Theer zu gewinnen (vgl.
1880 236 57), lassen F.
Ströhmer in Kötschenbroda und Th. Scholz in
Dresden (* D. R. P. Nr. 8174 vom 29. Mai 1879) gleich nach der Beschickung des Ofens
mit frischen Kohlen eine oder mehrere Röhren a (Fig.
1 bis 3 Taf. 33)
mit Gegengewicht n fast bis auf die Kohlen nieder, um
durch dieselben die sich bildenden gasförmigen Producte mittels Seitenröhren f in den Sammelkästen g
abzusaugen, ehe sie sich an den glühenden Wandungen des Ofens und der Kanäle umsetzen können. Damit
nun aber durch zu schnelles Absaugen der Gase nicht etwa die Beschaffenheit und
Ausbeute der Kokes leide, ist mit der Absaugevorrichtung ein selbstständiger
Druckregulator verbunden. Derselbe besteht aus einem von Eisen und feuerfestem Thon
hergestellten kurzen Vollcylinder c mit Gegengewicht
b. Sowie nun durch zu starkes Absaugen der Druck im
Ofen vermindert wird, geht der Cylinder herunter und verschliefst bei seinem
Niedergange die seitliche Absaugeöffnung o und zwar so
weit, bis das Gleichgewicht hergestellt ist, in welcher Stellung er so lange
verbleibt, bis im Fortgange des Processes der Druck sich ändert und er dann diesem
Drucke getnäfs Stellung nimmt. Will man keine Gase mehr auffangen, so wird die Röhre
a aufgezogen und der Schieber d eingeschoben. Das weitere Rohr e soll die Röhre a nach
dem Herausziehen aus dem glühenden Ofen vor dem Zerspringen schützen (vgl. 1879 234 * 383).
Um die zum Verbrennen der entweichenden Gase nöthige Luft
vorzuwärmen, wollen Dr. C. Otto und Comp. in Dahlhausen a. d. Ruhr (* D. R. P. Nr. 7054 vom 11. Februar 1879) die zur Bodenkühlung
verwendete und dadurch schon erhitzte Luft in besondern Kanälen durch die heiſsen
Ofenwände streichen lassen und sie dann zur Verbrennung der Gase benutzen. Eine
Batterie aus 17 Kokesöfen ist in Fig. 4 bis
9 Taf. 33 dargestellt.
Die zur Bodenkühlung verwendete Luft fällt bei den bisherigen Anordnungen durch die
Kamine a oder die punktirt angedeuteten Oeffnungen a1 in die Bodenkanäle
b, zieht unter der ganzen Länge der Ofenreihe,
theilt sich dann und geht in den Kanälen c an der
Vorder- und Rückseite der Oefen zurück, um stark erhitzt durch die
Ausströmungskamine d zu entweichen. Durch die
vorliegende Einrichtung soll nun die heiſse Luft aus den Kanälen c durch besondere, in den Trennungswänden der einzelnen
Kokesöfen ausgesparte senkrechte Pfeifen e und f in die horizontalen Kanäle g geleitet werden. Aus den Pfeifen e tritt
die heiſse Luft durch die schrägen Oeffnungen s (Fig.
9), aus den Pfeifen f durch die kleinen
wagrechten Verbindungskanäle u in die Horizontalkanäle
g, welche in der Mitte der Oefen bei h von einander getrennt sind, um die Luftzuführung von
der jeweiligen Windrichtung unabhängiger zu machen (vgl. Fig. 5). Von
hier aus geht die heiſse Luft durch zwei wagrechte Verbindungskanäie i in die Kanäle k und von
hier durch kleine Oeffnungen x zu den in die
Abzugspfeifen l strömenden Kokesofengasen. Die
Verbrennung der Gase wird durch entsprechende Schieber t und y in den Kanälen u und i geleitet.
Geringere Luftmengen werden in den Kanälen m, n und o (Fig. 4)
erwärmt, welche in den Gewölben der Oefen liegen und an den Köpfen derselben
unmittelbar mit der äuſseren Luft in Verbindung stehen.
Der Kanal m soll durch die Oeffnimgen v (Fig. 5) dem
Kanäle g heiſse Luft zuführen, wenn die Verkokung fast
vollendet, der Schieber bei t ganz geschlossen und der
Schieber bei y nur wenig geöffnet ist. Die Kanäle n und o führen die heiſse
Luft in den Horizontalkanal p, welcher durch kleine
Oeffnungen r mit dem Ofenraum selbst in Verbindung
steht, um beim Beginn der Verkokung einen Theil des Gases bereits im Ofen zu
verbrennen und so das Gewölbmauerwerk, welches durch die Gasentwicklung abgekühlt
wurde, wieder zu erhitzen. Ist dies erreicht, so werden die Kanäle n und o an den Köpfen der
Oefen durch Thonpfropfen geschlossen.
Tafeln