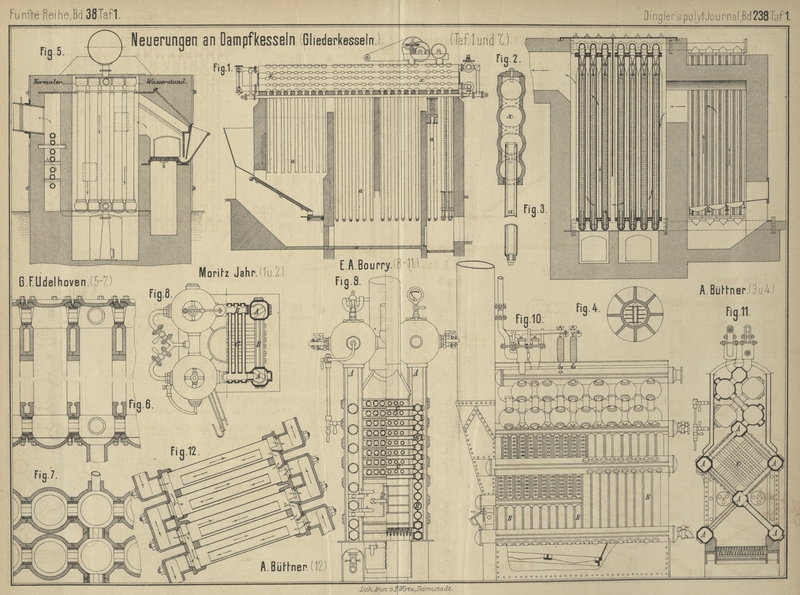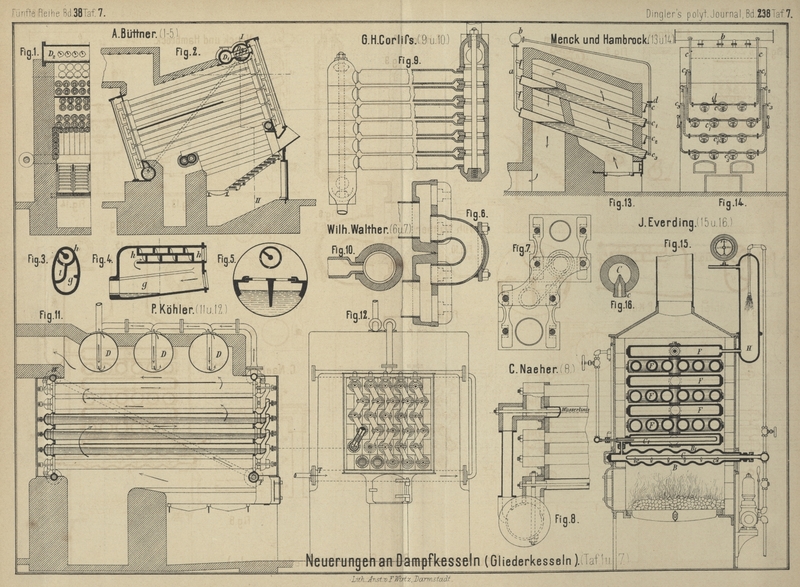| Titel: | Neuerungen an Dampfkesseln. (Patentklasse 13.) |
| Fundstelle: | Band 238, Jahrgang 1880, S. 11 |
| Download: | XML |
Neuerungen an Dampfkesseln. (Patentklasse 13.)
Mit Abbildungen.
Wehage, über Neuerungen an Dampfkesseln.
Gliederkessel. (Tafel
1 und 7.)
Wenn auch die aus lauter Röhren zusammengesetzten Dampfgeneratoren, für welche Prof.
Radinger den Namen „Gliederkessel“
eingeführt hat (entsprechend dem englischen „sectional boilers“), wegen ihres verhältniſsmäſsig geringen
Wasserinhaltes nur eine beschränkte Anwendung zulassen, so bieten sie doch so
bedeutende Vortheile, daſs in den letzten Jahren nach dem Vorgange von Belleville, Root u.a. viele Constructeure sich mit der
weitern Ausbildung derselben beschäftigt haben. Vor allem ist es wohl das
fortdauernde Bestreben, die beim Betrieb der Dampfmaschinen verwendeten
Dampfspannungen immer höher hinauf zu schrauben, dabei aber die Sicherheit der
Kessel nicht zu
gefährden, sondern wenn möglich zu erhöhen, was diesen Gliederkesseln mehr und mehr
Eingang verschafft. Indessen sind auch ihre übrigen Vorzüge: groſse Heizfläche,
rationelle Ausnutzung des Brennmaterials, bequemer Transport, die Möglichkeit, mit
denselben Elementen beliebig kleine und groſse Kesselanlagen herzustellen u.s.w.,
nicht unwesentlich. Die in den Neuconstructionen auftretenden Bestrebungen gehen nun
in der Regel darauf hinaus, ein bequemes Montiren, Demontiren und Reinigen der
Röhren zu ermöglichen, das Wasser vor dem Eintritt in die Röhren zu reinigen, einen
lebhaften Wasserumlauf (möglichst mit Gegenströmung) herzustellen, das Aufsteigen
der Dampfblasen zu erleichtern und besonders den Dampf möglichst gut zu trocknen;
der in der Regel sehr nasse Dampf ist ja einer der gröſsten Missstände der
Gliederkessel. Die Röhren werden gewöhnlich in horizontaler oder geneigter Lage in
Reihen oder Schichten angeordnet, seltener in verticaler Stellung, im letzteren
Falle meistens als Field'sche Röhren, um innerhalb jedes Rohres eine
Wassercirculation zu Stande zu bringen.
Der in Fig. 1 und
2 Taf. 1 skizzirte Gliederkessel von Moritz Jahr in
Gera (* D. R. P. Nr. 4698 vom 17.
August 1878) ist z.B. aus solchen Field'schen Röhren a zusammengesetzt. Dieselben sind in ein horizontal
liegendes Röhrenbündel x aus Guſseisen eingehängt und
mit der vom „Economiser“ bekannten Vorrichtung zum Abschaben des Russes
versehen (vgl. 1874 212 256). In die nicht direct über dem Roste liegenden Röhren
sind unten Metallpfropfen eingeschraubt, um die Reinigung zu erleichtern. Auf beiden
Langseiten der dünnwandigen Einmauerung sind groſse Blechkasten zum Vorwärmen des
Speisewassers und zur Ablagerung des Schlammes angebracht. In diese sind verticale,
behufs der Reinigung von Kesselstein herausnehmbare Wände eingesetzt, die
abwechselnd oben und unten Oeffnungen für den Umlauf des Wassers frei lassen. Da in
derartigen nicht unter Druck stehenden Vorwärmern die Temperatur des Wassers immer
unter 100° liegt, so ist auch die Ausscheidung des Kesselsteins in denselben eine
unvollkommene. Es ist deshalb auch bei diesen wie bei allen mit Field'schen Röhren
versehenen Kesseln ein Verstopfen der Röhren zu befürchten, wenn der Betrieb nicht
ein beständiger ist, oder wenn nicht eine häufige Reinigung vorgenommen wird.
Der Kessel der Rheinischen
Röhrendampfkessel-Fabrik A. Büttner und Comp. in Uerdingen a. Rh. und O. Intze in Aachen (* D. R. P. Nr. 4025 vom 4. August
1878) besteht, wie aus Fig. 3. Taf.
1 zu sehen ist, aus guſseisernen, mit äuſsern Längsrippen versehenen, verticalen
Röhren, welche reihenweise oben und unten durch Querröhren verbunden sind; diese
münden jederseits in ein gemeinschaftliches Sammelrohr. Die Vergröſserung der
äuſsern, die Wärme von den Heizgasen aufnehmenden Rohrfläche durch die Rippen
gegenüber der innern, die Wärme an das Wasser abgebenden Fläche soll unter
Berücksichtigung der Verschiedenheit der beiden Wärmeübergangscoefficienten die
beste Ausnutzung der innern Fläche ermöglichen. Jede der verticalen Röhren enthält,
wie die Field'schen, ein Circulationsrohr, das oben mit einer Vorrichtung zum
Trocknen des Dampfes versehen ist. Letztere besteht aus zwei in einander gesteckten
Düsen, von denen die untere andern Circulationsrohre, die obere an dem äuſsern Rohre
befestigt ist. Indem der Dampf gezwungen ist, durch die enge, zwischen beiden Düsen
bleibende ringförmige Oeffnung mit starker Richtungsänderung zu entweichen, wird
hierbei ein Theil des mitgerissenen Wassers ausgeschleudert. Der Kessel hat, wie
alle aus verticalen Röhren zusammengesetzten Kessel, eine sehr geringe
Wasseroberfläche. – Soll ein derartiges Röhrensystem als Speisewasser-Vorwärmer
benutzt werden, so wird in die Verticalröhren statt des innern Rohres ein aus einer
Anzahl Blechstreifen gebildeter Körper Fig. 4
eingehängt. Die Streifen sind durch Stehbolzen zu einem Ganzen verbunden und können
bequem nach oben herausgezogen werden. Da dieselben dem Wasser eine sehr groſse
Fläche darbieten, so ist anzunehmen, daſs sie den gröſsten Theil der Niederschläge
aufnehmen. Diese hindern aber dann den Wärmeübergang nicht und können nach dem
Herausnehmen der Blechstreifen leicht entfernt werden. Es erscheint mithin diese
Einrichtung ganz zweckmäſsig. Im Allgemeinen wird sich die beschriebene Anordnung
mehr für einen Vorwärmer, als für den eigentlichen Kessel eignen.
G. F.
Udelhoven in Kalk a. Rh. (* D. R. P. Nr. 5094 vom 19. October 1878) hat für den Kessel
Fig. 5 Taf. 1 nur einfache Verticalröhren (ohne Circulationsröhren)
verwendet. Dieselben sind oben und unten reihenweis durch Hohlkugeln mit einander
verbunden. Die Kugelköpfe greifen mit ihren Stutzen ein wenig in einander (Fig.
6 und 7) und
werden mit Hilfe innen achteckiger, auſsen mit Gewinde versehener Messinghülsen
zusammengeschraubt. Die obern Köpfe bilden mit ihren quadratischen Flanschen eine
zusammenhängende, den Feuerzug oben abschliessende Platte, während zwischen den
untern Köpfen Zwischenräume für den Durchgang der Feuergase bleiben. An allen Köpfen
sind Deckel aufgeschraubt, welche behufs Reinigung der Röhren abgenommen werden
können. – Die Reinigung wird häufig nöthig sein, da ein Wasserumlauf in den Röhren
kaum stattfinden wird. Irgendeine Vorrichtung zum Trocknen des Dampfes ist nicht
angegeben.
Sehr abweichend von den bisher bekannten Anordnungen sind die
Constructionen von E. A. Bourry in St. Gallen (* D. R. P. Nr. 5899 vom 10. October
1878). Derselbe baut Verticalkessel (d.h. solche, deren Grundfläche im
Vergleich zur Höhe gering ist) und Schiffskessel aus Röhren und Kugeln in folgender
Weise zusammen.
Bei dem Verticalkessel (Fig. 8 und
9 Taf. 1) bilden vier senkrechte, ziemlich weite Röhren A die Kanten eines quadratischen Prismas. Die vier
Seitenflächen desselben sind durch engere Röhren B
hergestellt, die mit angegossenen Rippen dicht auf einander liegen; unten ist das
Prisma durch den Rost, oben durch einen in den Schornstein übergehenden Trichter
abgeschlossen. Die Röhren B sind je an einem Ende
geschlossen, am andern in die Röhren A eingeschraubt,
und zwar in jeder Schicht abwechselnd die eine rechts, die andere links u.s.f. Die
Anordnung des Ganzen ist dabei derart, daſs zwei parallele, in gleicher Höhe
liegende Röhren B, die durch eine Anzahl noch engerer
Röhren C mit einander verbunden sind, mit zwei diagonal
gegenüber stehenden Eckröhren A in Verbindung stehen.
Die Röhren C liegen in Schichten kreuz weis über
einander und füllen den Raum zwischen den vier Wänden bis auf die für die Feuergase
nöthigen Durchgangsöffnungen aus. Durch diese Anordnung, durch welche besonders der
ungleichen Ausdehnung der verschieden stark erhitzten Röhren Rechnung getragen
werden soll, sind zwei in einander geschobene, nur unten und oben verbundene
Röhrensysteme hergestellt. Um in denselben eine lebhafte Circulation hervorzurufen,
ist jede der Eckröhren durch eine Längswand in zwei Abtheilungen getheilt, von denen
die äuſsere mit halbmondförmigem Querschnitt, die für das abwärts fliessende Wasser
bestimmt ist, mit den Röhren B nicht communicirt. Die
andere Abtheilung ist durch eine schräg eingesetzte Wand noch einmal getheilt, so
daſs für jede der beiden von einem Eckrohre unter rechtem Winkel abzweigenden
Röhrenschaaren B ein besonderer Kanal gebildet wird.
Aus dem einen unten weiten und oben engen Kanal soll das von unten aufsteigende
Wasser sich in die Röhren B und aus diesen in die
Röhren C vertheilen; in dem andern oben weiten und
unten engen Kanal soll das aus den Röhren B kommende
Wasser- und Dampfgemisch nach oben aufsteigen. Vier mit einander verbundene Kugeln,
welche die Röhren A oben abschlieſsen, dienen als
Dampfsammler. Der Schlamm soll in dem untern Theile der Eckröhren sich ablagern und
von hier zeitweilig abgeblasen werden. Um die Röhren reinigen zu können, ist sowohl
in den Röhren A, wie in den Röhren B jeder Rohrmündung gegenüber ein Pfropfen
eingeschraubt.
Bei dem Schiffskessel (Fig. 10 und
11 Taf. 1) liegen die Röhren A horizontal,
die Röhren B und C sind
unter 45° gegen die Horizontale geneigt. Den Dampfsammler bilden hier eine gröſsere
Anzahl Kugeln. Die Verbindung der Röhren ist dieselbe wie bei dem Verticalkessel. Um
die Wärmeausstrahlung möglichst zu beschränken, was ja bei Schiffskesseln aus
Gesundheitsrücksichten sehr wichtig ist, ist der ganze Kessel ummantelt, der obere,
den Dampfbehälter einschlieſsende Raum doppelt. Zwischen Röhren und Mantel soll eine
ununterbrochene, durch
Schieber regulirbare Luftströmung hergestellt werden, wodurch allerdings auch eine
unvortheilhafte Abkühlung der Röhren herbeigeführt wird. In der doppelten Stirnwand
des Kessels soll gleichfalls ein von oben nach unten gehender Luftzug stattfinden;
die hier erwärmte Luft wird unter den Rost geführt.
Ein Hauptnachtheil dieser in mancher Beziehung recht guten Constructionen liegt in
der Verbindung der einzelnen Theile. Dieselben sind mittels Differentialsehrauben
derart zusammengeschraubt, daſs Wasser und Dampf unmittelbar in das Gewinde
eindringen können und ein baldiges Einrosten zu befürchten ist. Der Dampf wird,
besonders bei dem Verticalkessel, sehr nass sein. Auch die hier verwendeten sehr
engen Röhren C sind wegen leicht eintretender
Verstopfung nicht zweckmäſsig.
Unter den Gliederkesseln, welche sich mehr an bekannte Formen
anschlieſsen, ist zunächst die neueste Construction von J. F.
Belleville in Paris (* D. R. P. Nr. 2468 vom 17. Juli 1877) zu erwähnen, welche
bereits in dem Bericht über die Pariser Ausstellung (1879 231 * 484) ausführlich
beschrieben ist.
Die Rheinische Röhrendampfkessel-Fabrik
A, Büttner in Uerdingen, welche hauptsächlich Gliederkessel nach dem System
Root baut, hat an diesen folgende Neuerungen (* D.
R. P. Nr. 467 vom 23. August 1877), angebracht. Die lichte Weite der Röhren, die
sonst 119mm betrug, ist für kleinere Kesselanlagen
auf 100mm vermindert, einmal, um dieselben auch in
und unter Räumen, in denen sich Menschen aufzuhalten pflegen, aufstellen zu
könnenBekanntlich gilt in Preussen die Bestimmung (vom 29. Mai 1871), daſs die
Rohrweite der Röhrenkessel, die in oder unter Wohnräumen aufgestellt werden,
nicht über 100mm betragen
darf., und zweitens, um möglichst viel Röhren auf kleinem Raum
unterbringen zu können, was namentlich bei Anwendung auf Schiffskessel wesentlich
ist. Ferner ist eine engere Anordnung der Röhren dadurch erreicht, daſs je zwei über
einander liegende Röhren jederseits in einem gemeinschaftlichen Kopfstücke befestigt
sind (vgl. Fig. 12
Taf. 1), wodurch zugleich die Zahl der Verbindungsstücke und der Dichtungsstellen
auf die Hälfte vermindert wird. Damit nun auch in den engeren Röhren ein lebhafter
Umlauf stattfinden könne, ist in jedes Rohr ein besonderes Circulationsrohr
eingelegt; auſserdem sind an den Verbindungsstücken Ablenkschirme (von dem
Constructeur des Kessels „Deflectoren“ genannt) angegossen. Es soll hierdurch
eine Strömung des Wassers, bezieh. des Wasser- und Dampfgemisches in der in Fig.
12 durch Pfeile angedeuteten Weise bewirkt werden.
(Schluſs folgt.)