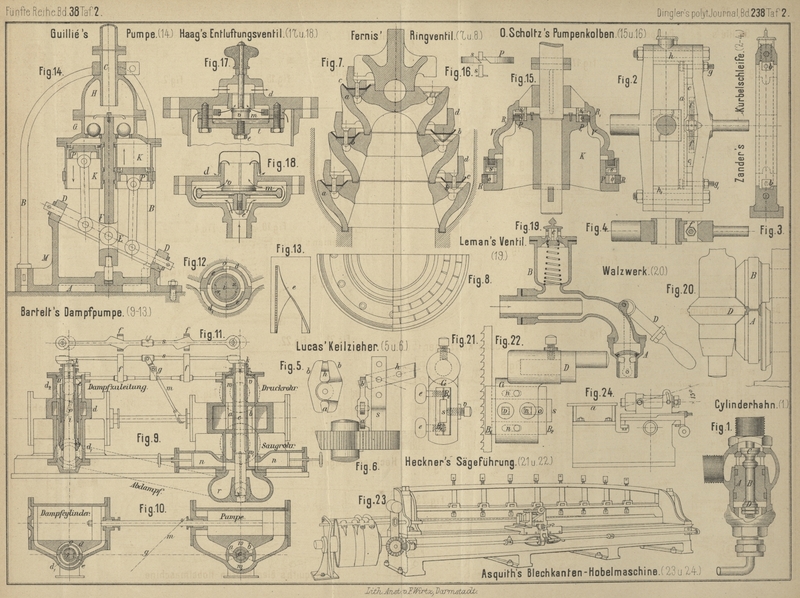| Titel: | E. L. Guillié's Pumpe. |
| Fundstelle: | Band 238, Jahrgang 1880, S. 21 |
| Download: | XML |
E. L. Guillié's Pumpe.
Mit einer Abbildung auf Tafel 2.
[Guillié's Pumpe.]
Die aus zwei einfach wirkenden Cylindern bestehende Pumpe von E. L.
Guillié in Villeneuve, Frankreich (*
D. R. P. Kl. 59 Nr. 8985 vom 12. October 1879) ist
durch die Anwendung einer eigenthümlichen Umsetzung der drehenden Bewegung in die
geradlinige Kolbenbewegung bemerkenswerth. Die beiden Giffard'schen Ventilkolben P (Fig. 14
Taf. 2) hängen an dem Balancier E, welcher um einen in
der verticalen Achse F befestigten Bolzen schwingt und
mit an seinen Enden aufgeschobenen Rollen D auf dem
Rand des an der Grundplatte A angegossenen, schief
abgeschnittenen Cylinders M aufliegt. Die Achse F trägt noch die beiden Cylinder K, deren Deckel mit dem Druckventilgehäuse G, den Windkessel H und
das Steigrohr C, welches sich in einem von den Stützen
B getragenen Halslager drehen kann.
Die ganze Pumpe steht unter Wasser. Sie wird angetrieben, indem das Steigrohr und
damit auch die Achse F in Drehung versetzt wird. Der
Balancier macht, indem hierbei die Rollen D auf der
Leitfläche des Cylinders M laufen, bei jeder
Wellendrehung eine Schwingung und jeder Kolben einen Doppelhub. Beim Niedergang
bleibt der Schleppring des Kolbens zurück; der letztere kann dann Wasser von unten
her ansaugen. Beim Aufgang legt sich der Schleppring wieder an den Kolben an und
sperrt dadurch die Säugöffnung ab.
Die Achse F mit den Cylindern u.s.w. könnte auch fest
stehen und statt derselben die Grundplatte A gedreht
werden. Auch läſst sich die Zahl der auf jede Umdrehung entfallenden Kolbenhübe
vergröſsern, wenn man der Leitfläche des Cylinders M
eine wellenförmige Gestalt gibt.
Tafeln