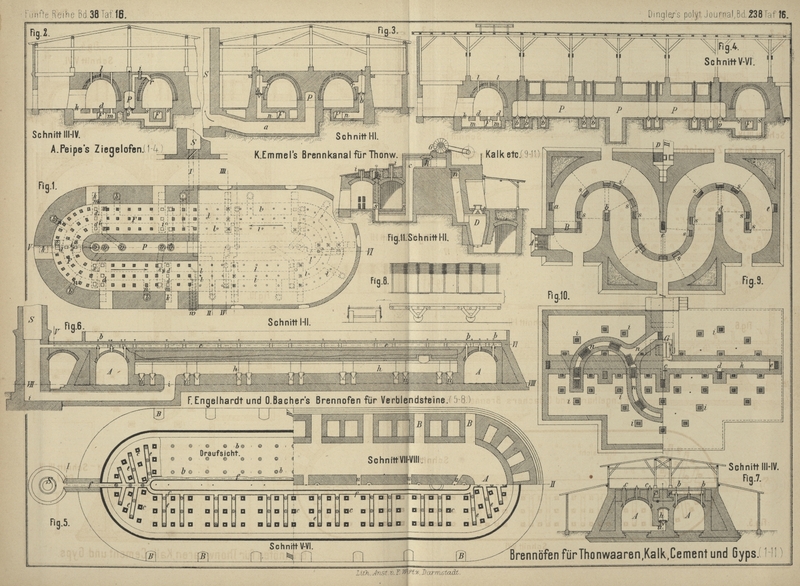| Titel: | Ueber das Brennen von Thonwaaren, Kalk, Cement und Gyps. |
| Fundstelle: | Band 238, Jahrgang 1880, S. 226 |
| Download: | XML |
Ueber das Brennen von Thonwaaren, Kalk, Cement
und Gyps.
Mit Abbildungen auf Tafel 16.
(Patentklasse 80. Fortsetzung des Berichtes S. 44
d. Bd.)
Ueber das Brennen von Thonwaaren, Kalk, Cement und
Gyps.
Einen länglich runden Ziegelofen für
ununterbrochenen Betrieb hat A. Peipe in Haynau, Schlesien (* D. R. P. Nr. 5777 vom 19. April
1878) construirt; derselbe ist in Fig. 1 bis
4 Taf. 16 in Grundriſs und Draufsicht sowie im Schnitte dargestellt. In
den ringförmigen Kanal F unter der Herdsohle münden die
zehn durch Glocken b verschlieſsbaren Querkanäle n, welche durch Oeffnungen r mit dem Ofenkanal in Verbindung stehen. Die ferner von dem Kanal F abgehenden Querkanäle m
münden mit 3 Oeffnungen d in den Ofenkanal, während die
Oeffnung k in der Einkarrthür liegt. Das Gewölbe einer
jeden Abtheilung ist bei i durchbrochen, um die
Verbindung r (Fig. 3) mit
dem Rauchsammler P durch zwei Schieber mit
Sandschüttung abzuschlieſsen. Mit Ausnahme der 30 Einfeuerungsöffnungen l, welche über den Verschlüssen d liegen, ist senkrecht unter jeder Oeffnung ein kleiner Rost von 15qc mit einem 15cm tiefen Aschenfall angebracht, welcher durch eine Röhrenleitung w (Fig. 1) von
auſsen mit frischer Luft gespeist werden kann, um die Verbrennung der angehäuften
Kokes zu erleichtern (vgl. H. Delbrück 1879 233 387).
Die Oeffnungen s in der Ofensohle führen nach dem mit
Glockenabschlüssen v versehenen Rauchkanal P, welcher durch den Kanal a mit dem Schornstein S in Verbindung
steht.
Wenn nun in dem Ofen geschmaucht werden soll, so wird die betreffende Abtheilung
durch den bei Ringöfen bekannten Schieberverschluſs abgeschlossen, die Verschlüsse
d des in die Abtheilung treffenden Kanales m durch Einsteigen bei k
geöffnet, der betreffende Deckel wieder zugemacht und nun die Abtheilung, nachdem
die Einkarrthür geschlossen, durch Ziehen der Glocke v
der zu schmauchenden Abtheilung mit dem Schornstein in Verbindung gesetzt. Wird nun
die Glocke b der zuletzt abgebrannten, noch stark in
Glut befindlichen Kammer gezogen, so geht die Hitze durch den Kanal F, unter den in Brand befindlichen Kammern weg, nach
der zu schmauchenden Abtheilung, tritt durch die Oeffnungen d an einem Ende in dieselbe ein und zieht am anderen Ende durch die
Oeffnungen s bei der jetzt offenen Glocke v vorbei zum Rauchsammler P. Gleichzeitig werden die Schieber i mit dem
Sandverschluſs entfernt und wird die obere Oeffnung mit einer Platte bedeckt, so
daſs die Wasserdämpfe auch durch die Verbindung r
entweichen können. Ist die Kammer abgeschmaucht, so werden die Verschlüsse d, Glocke b und Schieber
i geschlossen, der groſse Schieber zwischen dieser
und der im Feuer stehenden Kammer wird herausgezogen und im übrigen wie beim
gewöhnlichen Ringofenbetrieb verfahren.
Brennofen für ununterbrochenen Betrieb mit beweglicher
Schmauchvorrichtung für reinfarbige Verblendsteine von F. Engelhardt in Krempa bei Leschnitz und O. Bacher in Rosenthal bei Breslau (* D. R. P. Nr. 5625
vom 5. October 1878). Derselbe bildet wie gewöhnlich einen in sich verlaufenden
Kanal A (Fig. 5 bis
8 Taf. 16) mit den Thüren B, welche von oben
durch die Heizlöcher c befeuert werden. Der Abzug u führt zum Rauchsammler h
mit entsprechenden Glockenverschlüssen, welcher die Gase durch den Kanal i zum Schornstein S
führt.
Der Betrieb ist derselbe wie beim Hoffmann'schen Ringofen; eigenthümlich ist jedoch
die bewegliche Schmauchvorrichtung, bestehend aus einem viereckigen, eisernen, mit
Roststäben belegten Rahmen, dessen Länge fast der Breite des Ofenkanales gleich ist
und der auf 4 Rädern (vgl. Fig. 8) quer
durch den Brennkanal in einen ausgesparten Raum eingeschoben wird. Die entwickelten
Dämpfe gehen durch verschlieſsbare Oeffnungen b in der
Decke des Ofens zu einem Kanalsystem e, welches auf dem
Ofengewölbe zwischen den Heizlöchern unter dem Boden angebracht ist, zum Hauptkanal
f und dann in den Schornstein. Das Vorschmauchen
geschieht in 24 Stunden, in welcher Zeit die Kammern in den Ring der zu brennenden
Abtheilungen durch Entfernung des Schiebers eingefügt, die transportable
Schmauchvorrichtung aber in die neu besetzte Abtheilung gefahren wird.
Den Gasbrennofen von Escherich (1879
234 * 119) hat die Thonwaarenfabrik Schwandorf in
Schwandorf patentirt erhalten (vgl. * D. R. P. Nr. 6195 vom 11. September 1878 und
Zusatz Nr. 8003 vom 19. December 1878).
C. Emmel in Horde (* D. R.
P. Zusatz Nr. 6153 vom 6. November 1878) will jetzt einen Ofen mit schlangenförmig gewundenem Brennkanal für Thonwaaren, Kalk und
Cement verwenden (vgl. 1879 234 * 121). Die Feuerung A
(Fig. 9 Taf. 16) dient zum Ausschmauchen eines Theiles des Einsatzes und
dann zur Entzündung des zuerst eingelassenen Gases, worauf sie zugemauert wird. Die
Mauer B dient nur in der ersten Zeit des Brennens dazu,
den hinteren, noch leeren Theil von dem brennenden zu scheiden; dann wird sie
fortgenommen und der Betrieb ein ununterbrochener. Die 5 Zuglöcher a bis e stehen durch einen
über der Anlage hinführenden Hauptkanal k (Fig.
10) mit einem Luftsauger G in Verbindung, der
durch eine 1e-Maschine in Bewegung gesetzt wird.
Die Gase des Generators D (Fig. 11)
ziehen durch einen schrägen Kanal in die Höhe und durch auf der Mittelmauer wagrecht
hinführende Kanäle n weiter zu einer Oeffnung, durch
welche sie in der Mauer bis auf die Ofensohle hinunterfallen und dort bei s in den Ofen eintreten.
Beim Einsetzen der Steine werden Züge gebildet, die an ihren zwischen zwei Zuglöchern
liegenden Anfangs- und Endpunkten mit Lehm verschmiert werden, damit sich die Gase nicht zu
plötzlich in der Längenrichtung über den eigentlich brennenden Theil hinaus
vertheilen können. Die Deckschichten dieser Züge sind siebartig an mehreren Stellen
durchbrochen, so oft man es für zweckmäſsig hält, damit die Gase sich bequem in der
Höhenrichtung bewegen können; die Stoſs- und Lagerfugen der Kanalwandungen bleiben
offen, damit auch durch sie ein Theil der Gase durch die Querrichtung des Ofens
ausströmen kann. Wenn nun ein Theil der eingesetzten Steine durch die Feuerung A vorgewärmt ist, werden zwischen den ersten Kammern
die Gase eingelassen, welche sich an der Feuerung A
entzünden. Der Zug b bleibt hierbei geschlossen, c geöffnet. Hat man sich durch die im Gewölbe
befindlichen Schaulöcher i überzeugt, daſs der Inhalt
der ersten Abtheilung gar ist, so wird das betreffende Zugloch geschlossen und das
nächste geöffnet u.s.f. Ist der vorher gebrannte Ofentheil kalt, so wird er
entleert, sofort wieder gefüllt und die Thür vermauert. Besondere Querscheidungen,
wie sie bei anderen ähnlichen Constructionen nöthig sind, brauchen hier nicht
angewendet zu werden, weil die vorzuwärmende Strecke nach Belieben lang gewählt
werden kann, und die Ofenform verhütet im weiteren, daſs die durch die Thür, bei
welcher eingesetzt wird, eindringende kalte Luft schädlich auf die Feuerstelle
wirkt. Die im Grundrisse Fig. 9
punktirten Querlinien bezeichnen die Längen der jedesmal zu brennenden Strecken.
Tafeln