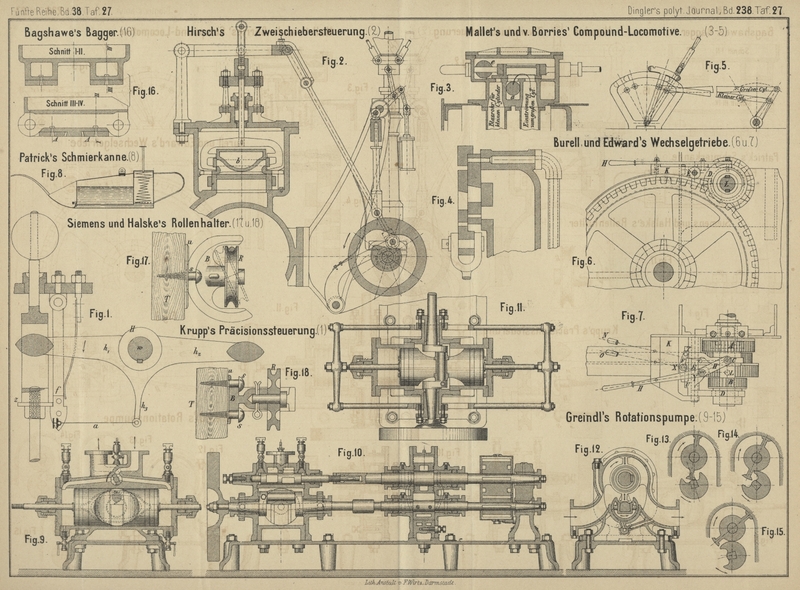| Titel: | Rotirende Pumpe, System Greindl, mit directem Antrieb. |
| Autor: | R. |
| Fundstelle: | Band 238, Jahrgang 1880, S. 380 |
| Download: | XML |
Rotirende Pumpe, System Greindl, mit directem
Antrieb.
Mit Abbildungen auf Tafel 27.
Greindl's rotirende Pumpe mit directem Antrieb.
Unter den verschiedenen Systemen rotirender Pumpen dürfte kaum ein anderes so
vielfache Anwendungen gefunden haben wie die von Baron
Greindl angegebene Construction (vgl. 1874 212 * 454). Obwohl auch ihre
wirkenden Organe, wie bei allen übrigen Pumpen dieser Klasse, zu den Kapselrädern
gehören (vgl. darüber Reuleaux's äuſserst lehrreiche
Abhandlung 1868 189 * 434) und speciell aus dem Evrardschen Ventilator (1868 189 *
442) entwickelt scheinen, so sind doch alle complicirten Zahnformen vermieden und
kommen nur Cylinderflächen mit einander in Berührung, ein Umstand, welcher sowohl
für die Herstellung, als Erhaltung von gröſster Wichtigkeit ist.
Wie aus Fig. 12 bis
15 Taf. 27 ersichtlich ist, sind hier die zusammenarbeitenden Kapselräder
durch zwei Cylinder gebildet, von denen der obere mit zwei an dem Pumpengehäuse
anliegenden Flügeln versehen ist, während der untere einen Ausschnitt enthält, um
den Flügel vorüber zu lassen. Selbstverständlich muſs dabei der untere Cylinder, da er nur einen Ausschnitt hat, die doppelte Tourenzahl machen
wie der obere; wollte man beide Cylinder gleich schnell laufen lassen, so wäre nur
der untere Cylinder entsprechend gröſser zu machen und mit zwei Ausschnitten zu
versehen, ähnlich dem Evrard'schen Ventilator.
Prinzipiell bieten diese beiden Fälle keinen Unterschied; doch leuchtet ein, daſs
die von Greindl gewählte Form für die praktische
Ausführung weitaus entsprechender ist.
In der Stellung der Fig. 12
liegt der eine Flügel des oberen Cylinders am Gehäuse an, der untere Flügel in dem
Ausschnitt des unteren Cylinders; durch die Drehung nach der Richtung der Pfeile
wird der links befindliche Raum der Pumpe vergröſsert und dadurch Wasser angesaugt,
rechts dagegen durch Verkleinerung des Pumpenraumes das früher angesaugte Wasser
weiter befördert. Die auf einander folgenden Phasen des Eingriffes sind in Fig.
13 bis 15
dargestellt; in Fig. 13
beginnt der Flügel den Einschnitt zu verlassen, in Fig. 14 ist
dies bereits geschehen und berühren sich nunmehr die Körper der beiden Cylinder
selbst und bilden hierdurch den erforderlichen Abschluſs zwischen Saug- und
Druckraum; in Fig. 15
endlich ist diese Bewegung noch weiter fortgeschritten.
So gelangt der obere Flügel immer weiter nach rechts und endlich vor die
Ausströmöffnung; damit nun hier keine Querschnittsverengung entstehen und dadurch
bedingte Geschwindigkeitsänderungen Veranlassung zu Wasserstöſsen geben, sind im
Gehäuse seitliche Taschen ausgenommen (vgl. Fig. 12),
auf welche die französischen Constructeure dieser Pumpen, nach Armengaud's Publication
industrielle, 1880 S. 42 zu urtheilen, besonderen Werth zu legen
scheinen.
Im weiteren Verlaufe kommt endlich der obere Flügel zum Eingriff in den Einschnitt
des unteren Cylinders und es beginnt links eine neue Periode des Saugens, rechts des
Entleerens der früher angesaugten Flüssigkeit.
Fig.
10 Taf. 27 gibt auf der rechten Seite den Querschnitt des Pumpenkörpers;
die Wellen der beiden Kapselräder sind durch Zahnräder gekuppelt, von denen das
obere doppelt so groſs ist wie das untere. Für gewöhnlich ist auf der einen oder
anderen Pumpenwelle eine Riemenscheibe zum Transmissionsantrieb der Pumpe aufgekeilt
und das ganze auf gemeinschaftlicher Grundplatte angeordnet; die in Kg. 12
ersichtlichen Verschraubungen dienen dabei zum Füllen bezieh. Enleereren der Pumpe,
der vom Druckraum über das untere Kapselrad führende Kanal zum Schmieren
desselben.
Die zum directen Antrieb der Pumpe dienende Maschine (Fig. 9 bis
11) ist eine Boxmaschine ähnlicher Construction wie die Maschine von Outridge (1878 227 * 327). Die gekröpfte Maschinenwelle
ist zwischen den Kolben zweier einfach wirkenden Cylinder gelagert, deren
Innnenflächen eine Kurbelschleife bilden, in welcher sich beim Hin- und Hergang der Kolben der
Kurbelzapfen auf und nieder bewegt. Die Steuerung erfolgt durch einen Drehschieber,
welcher mit der Achse des oberen Kapselrades der Pumpe verkuppelt ist; das untere
Kapselrad erhält seinen Antrieb direct von der Kurbelwelle aus.
Wie aus Fig. 10 und
11 ersichtlich, sind die beiden Kolben im Innern des Cylinders nicht mit
einander verbunden; dagegen haben die Kolbenstangen auſsen Querhäupter aufgesetzt,
welche durch Streben mit einander verbunden sind. Hierdurch sind beide Kolben zu
einem starren System vereinigt, lassen sich jedoch vermöge der Schraubenverbindung
mit den Querhäuptern einander nähern, falls die von ihnen gebildete Kurbelschleife
in Folge Abnutzung zu viel Spiel geben sollte. Die Streben sind selbstverständlich
in der Mitte, wo sie die Wellenlager durchsetzen, oval ausgefenstert.
R.
Tafeln