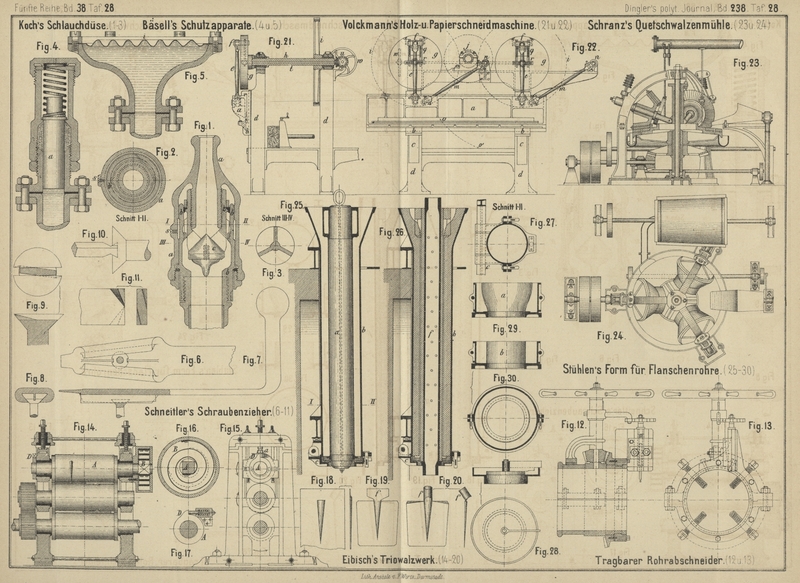| Titel: | W. Schranz's Quetschwalzenmühle für Erzaufbereitung. |
| Autor: | S–l. |
| Fundstelle: | Band 238, Jahrgang 1880, S. 389 |
| Download: | XML |
W. Schranz's Quetschwalzenmühle für
Erzaufbereitung.
Mit Abbildungen auf Tafel 28.
Schranz's Quetschwalzenmühle für Erzaufbereitung u.
dgl..
Einer der gröſsten Uebelstände beim Zerkleinern imprägnirter Erze besteht darin, daſs
die betreffenden Massen entweder nur eine kurze Zeit hindurch der Einwirkung der
zerkleinernden Kraft ausgesetzt bleiben und zum Theil in noch bei Weitem nicht genügend
aufgeschlossenem Zustande die Arbeitsmaschine verlassen, wie ganz besonders bei den
Walzwerken, oder daſs, wenn eine genügende Zerkleinerung erfolgt ist, das
hergestellte Korn nicht sofort der zerkleinernden Kraft
entzogen wird, daher einem längeren Pochen oder Abschleifen ausgesetzt bleibt, wie
bei den Pochwerken und Mühlen; hier erfolgt für einen groſsen Theil der Massen eine
feinere Zertheilung, als solche für die nachfolgenden Arbeiten nothwendig und
zweckmäſsig ist, wodurch die Erz Verluste bei der Aufbereitung nur begünstigt
werden. Ist nun auch, wenigstens bezüglich der Pochwerke, eine Herabminderung gerade
des letzt bezeichneten Uebelstandes durch die von Oesterreich ausgegangene Anwendung
der gestauten Ladenwasser erzielt worden und hat man vielfach versucht, auch bei den
Mühlen in ähnlicher Richtung die bessernde Hand anzulegen, so lassen doch die
bislang erzielten Erfolge noch immer genug zu wünschen übrig. Der neueste Vorschlag
geht vom Obersteiger W. Schranz zu Laurenburg a. d. Lahn aus (* D. R. P. Anmeldung Kl. 50 Nr. 18592 vom 9. August 1880).
Der für Massen von unter 10mm Korngröſse bestimmte
Schranz'sche Kollergang mit conischen Läufern und
Wasserspülung hat im Wesentlichen die aus Fig. 23 und
24 Taf. 28 ersichtliche Einrichtung. Das Mahlgut wird in die oscillirende
Auftragrinne aufgegeben und durch diese in geringerer oder gröſserer Menge – je
nachdem die Bewegung regulirt wird – auf die geneigte Ebene der Mahlscheibe
aufgeschüttet. Letztere dreht sich in der Richtung des Uhrenzeigers und versetzt
durch Reibung die drei conischen Walzen mit in Rotation, und zwar ist die Conicität
derselben so gewählt, daſs die sich berührenden Kreise gleiche
Peripheriegeschwindigkeit haben, so daſs nur ein Zerquetschen und kein Zerreiben
stattfindet. Die Walzen können durch Zusammenziehen der Gummibuffer und durch Senken
der auf der feststehenden Welle befindlichen Hülse, mit welcher die drei
Walzenachsen in Verbindung stehen, nach Erforderniſs auf die Mahlscheibe gepreſst
werden.
Das aufgetragene Mahlgut wird nun von der ersten Walze bis zu einer gewissen Gröſse
zerkleinert und, sowie es dieselbe passirt hat, von einem Wasserstrom getroffen und
zum Theil in die Sammelrinne geschwemmt. Die zu groben Körner werden durch den auf
beliebige Höhe verstellbaren Beistricher zurückgehalten und der zweiten Walze
zugeführt; nachdem solche durchlaufen ist, findet direct hinter derselben abermals
ein Abspülen der genügend zerkleinerten Körner und ein Weiterführen der zu groben
Theile nach der dritten Walze statt. Hinter dieser findet ein vollständiges Abspülen
statt, damit das neu aufgetragene Mahlgut stets auf reine Fläche trifft.
An der Mahlscheibe sind 3 Kratzen befestigt, welche das in der Sammelrinne sich
anhäufende Korn und Mehl mitnehmen und durch die in der Rinne befindliche Oeffnung nach der
Separationstrommel führen; diese ist so aufgestellt, daſs ihr Ausfall – wenn nöthig
– von Neuem durch den den Apparat bedienenden Arbeiter direct aufgegeben werden
kann.
Als Vortheile des Apparates werden angegeben: 1) daſs eine zu weit gehende,
nachtheilige Zerkleinerung bezieh. Schlämmebildung fast als ausgeschlossen
betrachtet werden kann; 2) daſs die der Abnutzung unterworfenen Theile stets
sichtbar sind, daher zur gehörigen Zeit ausgewechselt werden können, was am besten
so erfolgt, daſs Mahlscheibe und Walzen Ringe aus Stahl oder Hartguſs erhalten,
welche gegebenen Falles gegen andere zu vertauschen sind; 3) daſs der ruhige Gang,
welcher Stöſse und Schläge fern hält, eine rasche Abnutzung nicht erfolgen läſst,
endlich 4) daſs der Betrieb nahezu geräuschlos ist und die Anlagekosten gegenüber
denen der Pochwerke von gleicher Leistungsfähigkeit sich bedeutend geringer
stellen.
Wenn nun auch der beschriebene Apparat das angestrebte Ziel nicht im vollsten Umfange
erreichen wird, so erscheint doch der Vorschlag sehr beachtenswerth und weiterer
Ausbildung fähig. Die Maschinenfabrik Böhmer und Köster
in Limburg hat die Ausführung dieser Mühle übernommen.
S–l.
Tafeln