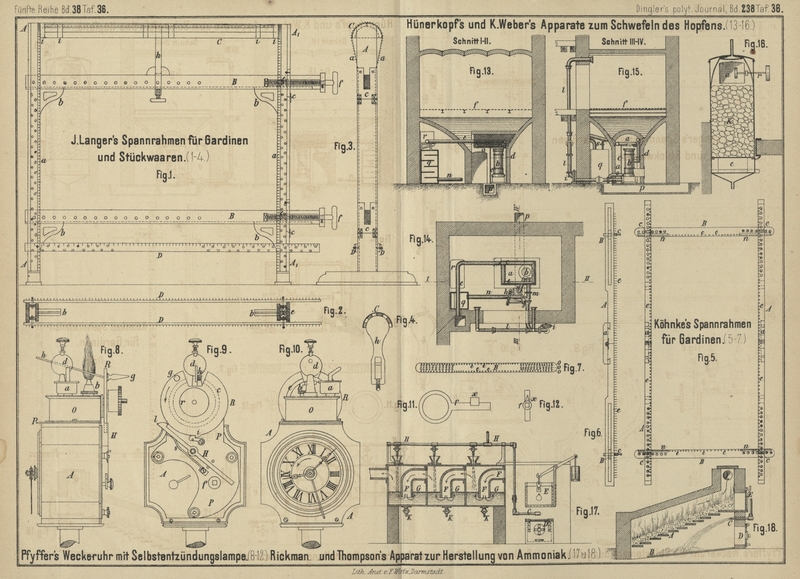| Titel: | Pfyffer's Weckeruhr mit Selbstentzündungslampe. |
| Fundstelle: | Band 238, Jahrgang 1880, S. 476 |
| Download: | XML |
Pfyffer's Weckeruhr mit
Selbstentzündungslampe.
Mit Abbildungen auf Tafel 36.
[Pfyffer's Weckeruhr mit Selbstentzündungslampe.]
Das Uhr- oder Weckergehäuse A (Fig. 8 bis
12 Taf. 36) ist von gewöhnlicher Einrichtung. Die Vorrichtung zum
Entzünden der Lampe, sowie diese selbst, befindet sich auf der hinteren und oberen
Seite des Gehäuses.
Die Lampe besteht aus dem Oelgefäſs O mit der
Eingieſsöffnung a und dem Brenner b. Die Scheibe R,welche
ihren Drehpunkt am oberen Ende der Platte P hat, ist
mit einer gerauhten Rinne c und einer in der Kapsel r eingeschlossenen Spiralfeder versehen; ferner besitzt
die Scheibe R wie ersichtlich einen Ausschnitt, welcher
nach Wirkung des Apparates die gezeichnete Lage einnimmt. Mittels des Handgriffes
g wird diese Scheibe in der Richtung des Pfeiles
herumgeführt, bis die vorspringende Nase i derselben
hinter die Nase l des zweiarmigen Hebels H zu liegen kommt; durch die Feder s wird dieser Hebel und mit ihm seine Nase l gegen die Scheibe R
gedrückt, wodurch deren Rücklauf so lange verhindert wird, bis der Wecker in
Thätigkeit tritt. Sobald dies geschieht, dreht sich der Schlüssel f (in Fig. 11 und
12 besonders dargestellt) und mit diesem seine Nase x zurück, wobei die letztere den unteren Arm des Hebels
H nach aufwärts bewegt, wodurch der andere Arm mit
der Nase l nach abwärts ausweicht. In Folge dessen wird
die Hemmung zwischen i und l aufgehoben, die Scheibe R springt vermöge
der ihr durch die Feder r mitgetheilten Kraft zurück;
dabei streicht die Rinne c an dem Zündstoff des im
Ständer d eingespannten Streichholzes h vorbei und entzündet dasselbe, worauf der Docht des
Brenners b sofort zu brennen anfängt. Diese Vorrichtung
ist sicher und wirksam.
Tafeln