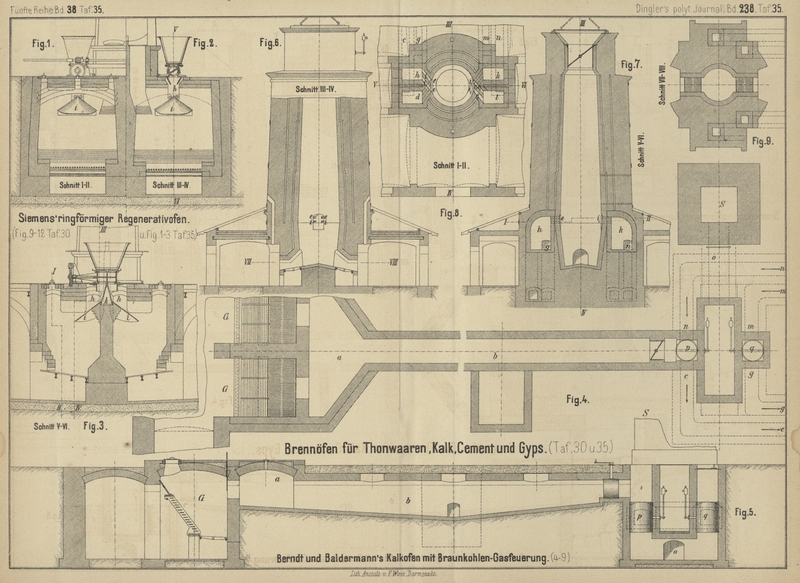| Titel: | Ueber das Brennen von Thonwaaren, Kalk, Cement und Gyps. |
| Fundstelle: | Band 238, Jahrgang 1880, S. 476 |
| Download: | XML |
Ueber das Brennen von Thonwaaren, Kalk, Cement
und Gyps.
Mit Abbildungen auf Tafel 35.
(Patentklasse 80. Fortsetzung des Berichtes S. 414
d. Bd.)
Ueber das Brennen von Thonwaaren, Kalk, Cement und
Gyps.
Um zur Erreichung einer gleichmäſsigen Temperatur einen möglichst
regelmäſsigen Gasstrom zu erhalten, werden die in Fig. 1 und
3 Taf. 35 dargestellten Gaserzeuger für den
F. Siemens und F. Hessischen Kanalofen (vgl. * S.
414 d. Bd.) in Gruppen von zweien oder vieren gebaut; die Kohlen werden jedoch nicht
auf die schiefe Ebene an der Vorderseite des Gaserzeugers gebracht, sondern durch
eine Oeffnung h, welche sich in der Mitte des Gewölbes
nahe der Hinterwand befindet, auf eine kegelförmige Fläche i, die aus Mauerwerk oder aus Eisen hergestellt ist. Indem die Kohlen beim Herabfallen diese
Fläche berühren, vertheilen sie sich gleichmäſsig über die Rostfläche. Sind die
kegelförmigen Flächen i aus Eisenblech verfertigt, so
befestigt man dieselben mittels Haken k an der Mauer,
so daſs sie leicht entfernt und erneuert werden können. Im übrigen haben die
Gaserzeuger die gewöhnliche Form von einem viereckigen Schachte, der unmittelbar
über dem Roste etwas eingezogen ist.
Der Kalkbrennofen mit
Braunkohlen-Gasfeuerung zu ununterbrochenem Betrieb von P. Berndt und J. Baldermann in
Fürstenberg a. d. Oder (* D. R. P.
Nr. 3509 vom 28. Mai 1878) ist in Fig. 4 bis
9 Taf. 35 dargestellt. Das im Generator G
(Fig. 4 und 5) aus
Braunkohlen erzeugte Gas sammelt sich in der Kammer a,
geht durch den Kanal b an der Wechselklappe p vorüber durch den Kanal c zum Regenerator d (Fig. 6 bis
9) und von hier aus durch die beiden Oeffnungen e in den mit rohem Kalk gefüllten Ofen. Die neben der anderen
Wechselklappe q eingetretene Luft geht durch den Kanal
g in den Regenerator h
(Fig. 6 bis 9), von wo
aus sie durch die Oeffnungen i in den Ofen tritt, um
sich mit dem Gase zu verbinden. Die heiſsen Verbrennungsgase durchstreichen den Kalk
und werden dann mittels des 27m hohen
Schornsteines S (Fig. 4 und
5) durch die Regeneratoren k und l und und die Kanäle m, n
und o abgesaugt. Nach halbstündigem Betriebe werden die
Klappen p und q
gewechselt, so daſs die heiſsen Gase nun durch die den Oeffnungen e und i genau gegenüber
liegenden Oeffnungen e1
und i1 in den Ofen
strömen und nach ihrer Ausnutzung durch die Regeneratoren h und d und die Kanäle c, g und o abgeleitet
werden.
Tafeln