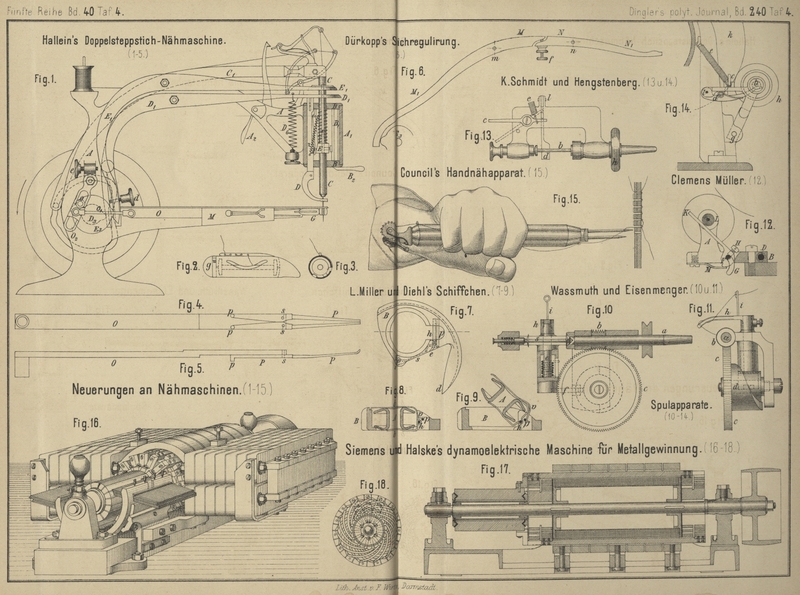| Titel: | Grosse dynamo-elektrische Maschine für Rein-Metallgewinnung im hüttenmännischen Betriebe; von Siemens und Halske in Berlin. |
| Fundstelle: | Band 240, Jahrgang 1881, S. 38 |
| Download: | XML |
Groſse dynamo-elektrische Maschine für
Rein-Metallgewinnung im hüttenmännischen Betriebe; von Siemens und Halske in
Berlin.
Mit Abbildungen auf Tafel 4.
Siemens und Halske's dynamo-elektrische Maschine.
Die Fig. 16 bis 18 Taf. 4
veranschaulichen diese interessante Maschine, welche bereits i. J. 1877 construirt
worden ist; dieselbe schlieſst sich in ihrem Aussehen an die ältere (liegende) Form
der Siemens und Halske'schen dynamo-elektrischen Lichtmaschine an (vgl. 1875 217 257).
Maschinen für elektrolytische Zersetzung (vgl. 1881 239 303) haben einen sehr starken
Strom, aber nur in einem äuſsert geringen Leitungswiderstand zu liefern. Deshalb
braucht die von ihnen entwickelte elektromotorische Kraft nicht sehr groſs, aber der
Leitungswiderstand ihrer Umwickelung muſs sehr klein sein, d.h., es müssen zwar
verhältniſsmäſsig nur wenig, aber sehr dicke Umwindungen vorhanden sein. Die
Umwindungen dieser Maschine sind nicht aus Draht hergestellt, sondern aus dicken
viereckigen Kupferbarren, welche passend zusammengefügt sind, wie es die
Stromführung erfordert.
Auf dem Inductionscylinder ist dabei die bekannte v. Hefner-Alteneck'sche Wickelung
und Schaltungsweise in der Art durchgeführt, daſs der Cylinder nur mit einer
Leitungslage bedeckt ist; die Ueberkreuzungen an den Stirnflächen sind durch
eigenthümlich geformte Kupferstücke von entsprechend groſsem Querschnitte
hergestellt, wie in Fig. 18,
welche die Stirnfläche, und in Fig. 17,
welche den Längsschnitt des Inductionscylinders zeigt, deutlich zu sehen ist. Die
Verbindungen mit den Sectoren des Commutatorcylinders sind durch starke kupferne
Winkel bewerkstelligt. Auf den Schenkeln befindet sich auch nur eine Umwindungslage
und, wie Fig. 16
erkennen läſst, nur 7 Umwindungen auf jeder derselben. Der Leitungsquerschnitt jeder
Umwindung beträgt 13qc. Die Verbindungsstellen
sind sämmtlich verschraubt und verlöthet. Die Isolationen zwischen den einzelnen
Umwindungen und den anderen Maschinentheilen sind durchweg aus unverbrennlichem
Asbest hergestellt. Dies gestattet, die Leistungsfähigkeit der Maschine so hoch zu
steigern, daſs sogar ihre so sehr dicken Leitungstheile ohne Gefahr für die Maschine
noch sehr heiſs werden können. Sie werden in Wirklichkeit auch sehr warm, trotzdem
ihre nach auſsen hin überall blank liegenden und geschwärzten Kupferflächen eine
ausnahmsweise gute Abkühlung bewirken; es mag schon dieser Umstand Jedem, der einmal
mit elektrischen Erwärmungsversuchen zu thun hatte, eine ungefähre Vorstellung von
der Stärke des auftretenden Stromes geben.
In dem kgl. Hüttenwerk zu Oker i. H. sind augenblicklich drei solcher Maschinen Tag
und Nacht in unausgesetztem Betriebe, eine derselben seit über 2 Jahren und zwei
weitere kommen demnächst zur Aufstellung. Jede derselben liefert den Strom für 10
bis 12 groſse Niederschlagszellen; in jeder Zelle werden in 24 Stunden 25k Kupfer niedergeschlagen; im Ganzen liefert also
eine Maschine 250 bis 300k täglich bei Verbrauch
von 8 bis 10e. Der innere Widerstand der Maschine
beträgt ungefähr 0,00070 S. E., die elektromotorische Kraft ungefähr drei Daniell,
die Stromstärke ungefähr 800\,\frac{Daniell}{\mbox{S. E.}}.
Diese Angaben gelten für ein Rohkupfer, das nicht über 0,5 Proc. Unreinigkeit
enthält. Je unreiner das Kupfer ist, desto gröſser ist, die elektrische Polarisation in
den Zellen und desto weniger lohnend ist die Anlage, da die Ueberwindung dieser
Polarisation erhebliche Arbeitskraft kostet. Am stärksten ist diese Polarisation,
wenn Gasentwicklung auftritt, also z.B. bei der Wasserzersetzung; die elektrische
Scheidung wird daher in solchen Fällen nur angewendet werden, wenn die Arbeitskräfte
sehr billig oder die Niederschlagproducte sehr werthvoll sind. Unmittelbar und ohne
Schwierigkeit ausführbar dagegen ist die Anwendung von Maschinen in allen
elektrolytischen Processen, in welchen die Lösung ihre Zusammensetzung nicht
verändert und die elektrische Differenz der Elektroden unbedeutend ist.
Kleinere derartige Maschinen werden theils auch für hüttenmännischen Betrieb, theils
für die Bedürfnisse der Galvanoplastik gebaut. Sämmtliche Maschinen dieser Art
erhalten verschiedene Schaltung (im Inneren der Maschine) und Wickelung, je nachdem
die in den Zellen auftretende Polarisation unerheblich ist wie beim Verkupfern, oder
bedeutend wie beim Vernickeln, Vermessingen u. dgl. Im ersteren Fall werden
Schenkel, Anker und äuſserer Widerstand hinter einander, im letzteren Fall parallel
geschaltet; die Parallelschaltung hat den Vorzug, daſs durch dieselbe ein Umschlagen
der Pole der Maschine unmöglich gemacht wird.
Tafeln