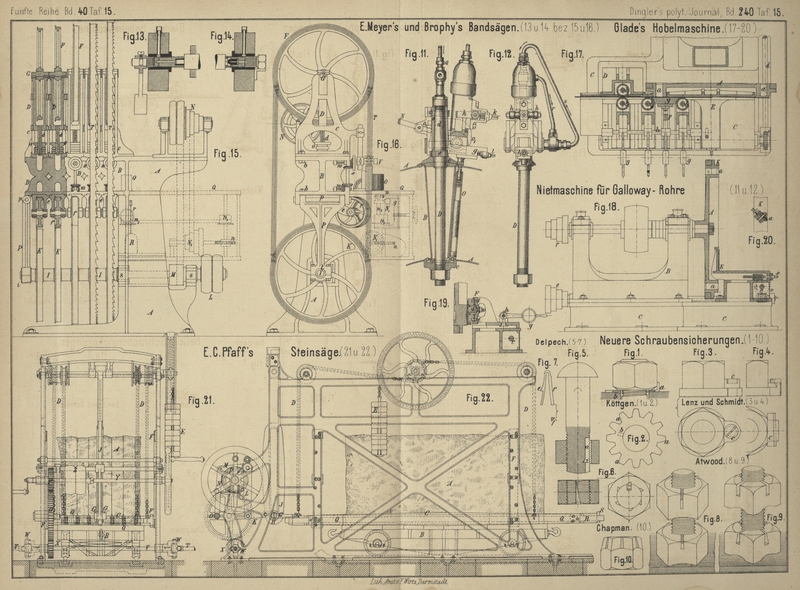| Titel: | Steinsäge von E. C. Pfaff in Chemnitz. |
| Fundstelle: | Band 240, Jahrgang 1881, S. 183 |
| Download: | XML |
Steinsäge von E. C. Pfaff in
Chemnitz.
Mit Abbildungen auf Tafel 15.
Pfaff's Steinsäge.
Die in Fig. 21 und 22 Taf. 15
in 2 Ansichten dargestellte Maschine (* D. R. P. Kl. 80 Nr. 4100 vom 25. Mai 1878)
bezweckt, die menschliche Kraft in bequemer und wirkungsvoller Weise auf eine
Steinsäge zu übertragen und das bisher zumeist nur mit Handsägen oder durch Sprengen mittels Keil
bewerkstelligte Zerlegen von Steinblöcken durch einen einfachen Mechanismus
verrichten zu lassen. Der Betrieb der Maschine ist jedoch nicht auf die Hand allein
angewiesen, sondern, da in den meisten Steinbrüchen oder da, wo Steine zur
Verarbeitung gelangen, gewöhnlich auch thierische Kräfte zur Verfügung stehen, es
ist auch die Einrichtung zum Betriebe mittels eines Göpels angebracht;
erforderlichen Falles kann, da auf der Antriebwelle Los- und Festscheibe sitzen,
auch Elementarkraft zur Verwendung gelangen.
Das Werkstück A ist auf einem über Schienen laufenden
Wagen B befestigt, auf welchem es entweder nur an den
Auſsenseiten bearbeitet, oder mittels mehrerer Schnitte in einzelne Platten zerlegt
werden kann. Die Sägeblätter sind im Sägenrahmen C
eingespannt, welcher an Ketten D hängt, dessen Gewicht
durch eine aus einzelnen Theilen bestehende Gegenlast E
regulirt werden kann. In der Zeichnung ist dieser Rahmen in seinem tiefsten Stand,
nachdem er also den Steinblock bereits durchschnitten hat, angenommen. Durch
verticale Führungsgeleise F, welche stellbar sind und
in dem Maſse, als sie sich abnutzen, nachgerückt werden können, ist eine genaue
Bewegung des Sägenrahmens C in der Breitenrichtung
erzielt. Mittels zweier Laschen G und einer zwischen
diesen befindlichen Rolle H ist dieser Rahmen mit einem
vertical hin – und herschwingenden Pendelbaum J derart
in Verbindung gesetzt, daſs, wenn letzterer durch die an seinem unteren Theile
angeschlossene Zugstange K, durch die Hebel L, M, N und die Zahnräder O,
P eine oscillirende Bewegung erhält, ersterer mit den in ihm eingespannten
Sägen eine zertrennende Wirkung auf das Arbeitstück ausübt. Der Sägenrahmen C kann hierbei vollständig frei sich vertical abwärts
bewegen und zwar in dem Maſse, als es während des Schneidens die Gröſse des
Gegengewichtes bezieh. der Widerstand des zu schneidenden Materials gestattet; es
ist hierbei der Rolle H, welche in dem langen Schlitz
des Pendelbaumes gleitet, keinerlei Widerstand entgegengesetzt. Die Sägenblätter Q, welche der Rahmen C
tragt, werden ebenso in diesem eingesetzt, wie es bisher bei den Steinsägen üblich
war, nämlich mittels Kloben R und Keilen S. Diese Sägeblätter selbst sind ohne Zähne und
verrichten ihre Arbeit als Sägen nur durch Anwendung von scharfem Quarzsand, welcher
während des Schneidens in die Schnittfugen geworfen und durch einen oder mehrere
Wasserstrahlen naſs gehalten wird.
Um ein Göpelwerk zum Betrieb zu verwenden, wird dessen Welle T, je nachdem es die räumlichen Verhältnisse erfordern, rechts oder links
an einem Ende der nahe dem Fuſsboden befindlichen und in beiden Gestellwänden
gelagerten Welle V durch ein Universalgelenk W angeschlossen und durch ein auf dieser Welle
sitzendes und in das darüber liegende Zahnrad O
eingreifendes Getriebe X eine Verbindung mit dem oben erwähnten
Mechanismus erzielt. Die auf der Schwungradwelle Y
befindlichen Fest- und Losscheiben Z dienen zum
Betriebe dieser Maschine durch Elementarkraft.
Diese Maschine schneidet weit schneller, als dies durch Handsägen möglich ist, und
liefert bei jedem Schnitt zwei ebene Schnittflächen, welche weit weniger Nacharbeit
als durch Sprengen entstandene Bruchflächen erfordern, vielmehr fast ohne
nennenswerthe Nacharbeit zum Anreiſsen etwaiger Profile o. dgl. geeignet sind;
endlich ist mit dieser Steinsäge das Schneiden von Platten in den schwächsten
Dimensionen möglich und der Schnittverlust, d.h. die Breite der Schnittfugen, weit
geringer als beim Trennen nach anderer bisher üblicher Weise. Ihre Dimensionen
gestatten das Zerlegen von Steinblöcken bis 2m,5
Länge, Im Breite und 1m Höhe.
Tafeln