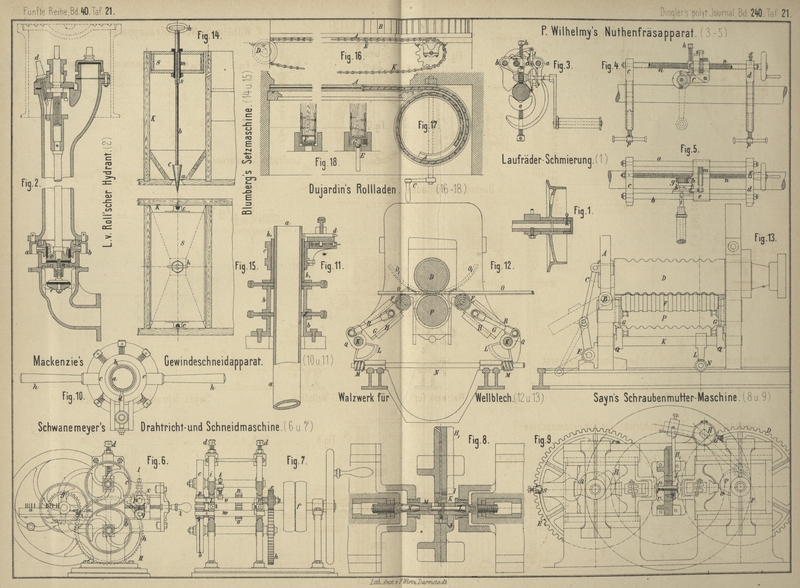| Titel: | Hydrant mit selbstthätiger Entwässerung. |
| Fundstelle: | Band 240, Jahrgang 1881, S. 256 |
| Download: | XML |
Hydrant mit selbstthätiger
Entwässerung.
Mit einer Abbildung auf Tafel 21.
Hydrant mit selbstthätiger Entwässerung.
Wie früher (1881 239 * 435) bemerkt, ist ein Haupterforderniſs jeder selbstthätigen
Entwässerungsvorrichtung, daſs der Entwässerungskanal geschlossen ist, bevor der
Wasserdurchgang frei wird. Diesem Umstände scheint die selbstthätige
Entwässerungsvorrichtung für Wasserpfosten (Hydranten) der Gesellschaft der Ludwig von Roll'schen Eisenwerke in Clus bei Balsthal, Schweiz (* D. R. P. Kl. 85 Nr. 12507 vom 6. Juni 1880) vor allen Dingen genügen zu
wollen. Dieselbe gehört zu jenen Apparaten, bei denen das abflieſsende Wasser nicht
in einem Behälter gesammelt wird, sondern ins Erdreich abgelassen wird, um sich dort
zu verlaufen.
Damit man beim Verstopfen der Entwässerungsöffnung nicht jedesmal den Hydranten
ausgraben muſs, sind hier zwei oder mehrere Oeffnungen a,
b (Fig. 2 Taf.
21) angebracht, von denen jedoch stets nur eine (b) in
Thätigkeit ist, während die andere (a) in allen
Höhenlagen des Ventiles c verschlossen bleibt. Verstopft sich nun z.B. die Oeffnung
b, so wird, nachdem die Stellschraube d ausgelöst ist, das Ventil c so weit gehoben, bis das lose mit ihm verbundene Ventil e an der Unterseite des Sitzes anliegt, wo dasselbe
dann durch den Wasserdruck angepreſst wird. Jetzt kann der Deckel abgenommen und das
Ventil c (wenn nur zwei Entwässerungsöffnungen
vorhanden sind) um 180° gedreht werden, so daſs nun die Oeffnung a zur Wirkung kommt. Bei der üblichen
Ventilconstruction ist es unvermeidlich, daſs während des Oeffnens und Schlieſsens
oder bei unvollständig geöffnetem Ventil Wasser unter Druck aus der Leitung durch
die Entwässerungsöffnung ins Erdreich gepreſst wird. Um diesem Uebelstande zu
begegnen, erhält das Ventil c an der Unterseite eine
fest mit ihm verbundene Platte o, welche wie ein Kolben
schlieſsend in den Ventilsitz hineingreift.
Die Höhe dieser Platte ist so bemessen, daſs die Entwässerungsöffnung geschlossen
sein muſs, wenn der Wasserdurchgang offen ist. Aus diesem Grunde ist es auch
zulässig, die Entwässerungsöffnungen gröſser zu machen als sonst, also die Gefahr
des Verstopfens noch zu vermindern.
Tafeln