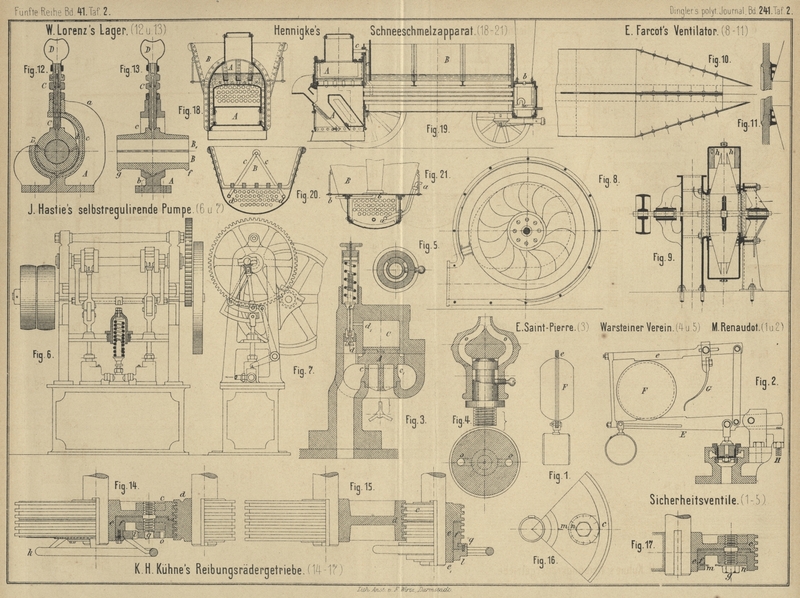| Titel: | W. Lorenz's Lager für Wellenleitungen. |
| Fundstelle: | Band 241, Jahrgang 1881, S. 17 |
| Download: | XML |
W. Lorenz's Lager für Wellenleitungen.
Mit Abbildungen auf Tafel 2.
W. Lorenz's Lager für Wellenleitungen.
Die unbestreitbaren Vorzüge der amerikanischen Transmissionslager haben denselben in
Deutschland sehr schnell eine groſse Verbreitung verschafft. Auch die in Amerika
lange übliche Methode der Massenfabrikation von Transmissionstheilen gewinnt bei uns von Jahr zu Jahr fester
an Boden. Eine Folge davon ist das Streben nach möglichster Einfacheit der
Construction und gewisse kleine Verbesserungen, welche für eine einzelne Ausführung
nur geringen Werth hätten, erhalten unter Umständen in Hinsicht auf die
Massenfabrikation eine erhöhte Bedeutung. Aus diesem Grunde sei auf das in Fig.
12 und 13 Taf. 2
skizzirte Transmissionslager von W. Lorenz in
Karlsruhe i. B. (* D. R. P. Kl. 47 Nr. 13323 vom 27.
April 1880) näher hingewiesen. Es besteht im Wesentlichen aus vier Theilen: dem
eigenthümlich geformten Lagerkörper A, der Unterschale
B, der Oberschale B1 und der Druckschraube C; letztere nimmt gleichzeitig den Schmiertopf D auf. Die nothwendige Bearbeitung dieses Lagers beschränkt sich also auf
das Ausbohren der beiden Lagerschalen und die Anbringung der Druckschraube. Die
guſseiserne kugelige Unterschale B paſst mit geringem
Spiel in die entsprechende Kugelform des Stuhles und ist nur durch die Warze b unterstützt. Die Welle ist demnach gewissermaſsen nur
in einem Punkt gelagert und kann sich zum Lagerstuhl selbstthätig einstellen. Die
Druckschraube C sichert die Oberschale, welche gegen
Längsverschiebung dadurch geschützt ist, daſs sie bei d
etwas in die Höhlung des Armes A hineingreift.
Die mit langem Gewinde in den übergreifenden Arm des Stuhles eingeschraubte
Druckschraube C überträgt nach oben gerichteten Druck,
auftretende Stöſse u. dgl. derartig auf den Arm A, daſs
in dessen T-förmigem Querschnitt die günstigste Inanspruchnahme des vertheilten
Stoffes eintritt. Der entstehende Zug wird hauptsächlich von der breiten Rippe c, der Druck von der Rippe a aufgenommen. Dieselbe günstige Verwerthung des T-förmigen Querschnittes
des Lagerstuhles ergibt sich bei seitlichem Druck, da dieser Querschnitt die Welle
nahezu rings umschlieſst.
Die linke Seite des Stuhles ragt nur wenig über die Mitte des Lagers hervor und, da
der Arm a erhöht liegt, genügt es, die Druckschraube
C um wenige Windungen zurückzudrehen, um die obere
Schale B1 abnehmen und
die Welle seitlich ausheben zu können. Die Druckschraube C ist in ihrer ganzen Länge durchbohrt und nimmt in ihrem Kopf das
Oelgefäſs D auf. Ein Kupferröhrchen führt das Oel bis
auf die Welle. Damit das Oel seitlich nicht aus dem Lager austrete, sind die
Schalenfugen schräg angeordnet. Das Oel kann also nur an den Enden der Schalen
austreten, wo es sich an den kleinen Wülsten f und g sammelt, abtropft und aufgefangen wird. Die
Schalenfugen gestatten auch eine geringe seitliche Verschiebung des Lagermittels,
wobei sich die Schalen um Parallelen zur Wellenachse drehen, welche durch die Warze
b bezieh. die Spitze der Schraube C gehen.
Tafeln