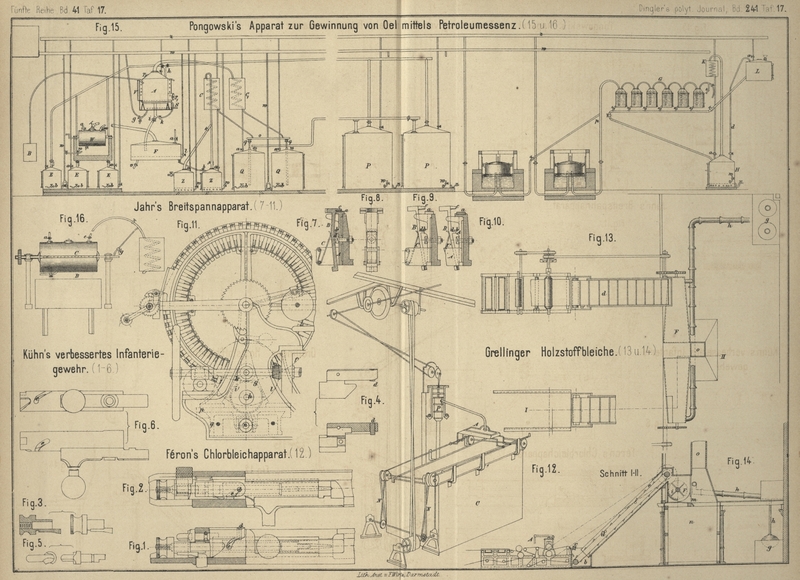| Titel: | Ueber das Bleichen von Faserstoffen. |
| Fundstelle: | Band 241, Jahrgang 1881, S. 192 |
| Download: | XML |
Ueber das Bleichen von Faserstoffen.
Mit Abbildungen auf Tafel 17.
Ueber das Bleichen von Faserstoffen.
Zum Bleichen von verarbeiteter
Baumwolle, namentlich von Baumwolle auf Bobbinen, werden nach J. A. Engeler in Winterthur, Schweiz (D. R. P. Kl. 8
Nr. 12127 vom 26. Juni 1880) die gefüllten Bobbinen in einen geschlossenen, mit Blei
o. dgl. ausgefütterten Behälter gebracht, welcher bei 3m
Länge, 2m Höhe und 1m,5 Tiefe 150k Baumwolle faſst. Dieser
Behälter steht durch ein Kautschukrohr mit einem Apparat in Verbindung, in welchem
man aus einem Gemenge von 1 Th. ungelöschtem Kalk, 1 Th. Chlorkalk, 1 Th. Weingeist
oder Essigsäure und 4 Th. Wasser mit der erforderlichen Menge Schwefelsäure etwa
2cbm,5 Chloroformdämpfe entwickelt, welche man
unter einem Druck von etwa 2at 2 Stunden lang auf
die Baumwolle einwirken läſst, worauf die Bleichung vollendet ist. Nun leitet man
ein Gemenge von Wasserstoff, Kohlensäure und Aetherdämpfen ein, woraut nach Verlauf
von 15 Minuten jeder Geruch aus den Bobbinen entfernt ist und dieselben dem Verkauf
übergeben werden können.
Um Jute zu bleichen, soll dieselbe
nach A. Girardoni (Englisches Patent Nr. 3359 vom 20.
August 1879) in eine mit Schwefelsäure angesäuerte Lösung von Kaliumdichromat
gebracht, sodann mit Chlorkalk oder unterschwefligsauren Alkalien und schlieſslich
mit übermangansaurem Kalium behandelt werden.
Nach J. M. Clement (Industrieblätter, 1880 S. 341) werden die zu bleichenden Gewebe zur Entfernung der Schlichte in
mit Hefe versetztes Wasser getaucht und nach beendeter Gährung in ein Oxydationsbad
gebracht, welches aus 1000l Wasser mit 0k,5 eines oxydirenden Salzes besteht. Zur
Herstellung dieses Salzes werden 670g
übermangansaures Kalium und 330g dichromsaures
Kalium oder 450g übermangansaures Kalium, 100g dichromsaures Kalium und 390g schwefligsaures Natrium in Wasser gelöst und zur
Krystallisation verdampft, wobei angeblich keine Zersetzung eintreten soll. Nach 1
Stunde kommt der Stoff in ein zweites Bad, bestehend aus 1000l Wasser, 1500g
schwefligsaures oder unterschwefligsaures Salz, 750g Schwefelsäure oder 875g Salzsäure und
250g kohlensaures Natrium oder Kalium. Nach
2stündiger Berührung spült man und bringt den Stoff in ein Bad von 370g unterchlorigsaurem Natrium, 2500g kohlensaurem Natrium und 1000l Wasser. Die Entfärbung von Baumwolle ist nach 8
bis 10 Stunden meistens erreicht; man hat nur noch zu spülen, ein zweites Bad 1
Stunde lang anzuwenden, wieder zu spülen und wie gewöhnlich zu appretiren. Bei
Leinwand sind diese Operationen in derselben Reihenfolge zu wiederholen.
Der mechanische Chlorbleichapparat
von Ch. Féron in Condé sur Noireau, Frankreich (* D, R.
P. Kl. 8 Nr. 12 749 vom 19. Mai 1880) bezweckt, die Handarbeit durch mechanische
Vorrichtungen zu ersetzen und das Chlorgas vollständiger auszunutzen, als dies
bisher geschah. Die beiden Hauptbestandtheile der in einem mit Glasscheiben
versehenen Kasten eingeschlossenen Maschine sind der Aufguſswagen A (Fig. 12
Taf. 17) und die Pumpe P; ersterer hat den Zweck, auf
die in der Kufe C befindliche Waare die Bäder von Chlor
und Säure in flüssiger
Form gleichmäſsig und ununterbrochen zu verbreiten, welche derselben mittels der
Pumpe P aus einer neben dem Kasten aufgestellten Kufe
zugeführt werden. Der mittels eines entsprechenden Getriebes und endlosen Ketten N über den Kasten C hin
und her geführte Aufguſswagen A ist am zweckmäſsigsten
aus Hartgummi oder aus Holz mit einem Ueberzug von Guttapercha gefertigt. Der
Pumpenkolben besteht am besten aus demselben Material, der Pumpenkörper aus Glas
oder Porzellan von genügender Stärke. Die Rohrverbindungen bestehen aus Kautschuk
oder Guttapercha mit eingelegter Spirale.
Zum Bleichen von geschliffenem Holz
nach dem erwähnten Verfahren (1880 237 331) verwendet die
Gesellschaft für Holzstoffbereitung in Grellingen bei Basel (* D. R. P. Kl. 55 Zusatz Nr. 11 954 vom 18. April 1880) den in Fig.
13 und 14 Taf. 17
dargestellten Apparat. Der ungebleichte, noch ungefähr 50 Proc. Wasser enthaltende
Holzstoff gelangt von der Nachpresse A in den Kasten
b, nachdem er vorher mit Hilfe der Messer- oder
Stachelwalze c in kleine Flocken zerrissen wurde. Von
hier aus werden die Flocken mittels des endlosen Tuches d, auf welchem kleine Querleisten angebracht sind, nach dem eigentlichen
Bleichkasten F befördert, in welchen die in den
Retorten g entwickelte schweflige Säure durch die
Rohrleitung h eingeleitet und dort mit dem Holzstoff in
innige Berührung gebracht wird. Um letztere möglichst vollkommen zu machen, wird der
Stoff in dem Kasten durch die mit Schlagleisten i
schraubenförmig besetzte Welle beständig aufgerührt und gleichzeitig der
Einströmungsöffnung des Gases entgegengeführt. Der an dem breiten Ende des Kastens
angelangte Holzstoff fällt alsdann durch die Oeffnung m
in den Behälter n, um von dort von Zeit zu Zeit
weggenommen und auf den Stock oder in Säcke geschlagen zu werden, woselbst die in
dem Stoff befindliche Säure ihre bleichende Wirkung fortsetzt und vollendet. Der
Behälter n steht mit dem Schornstein o in Verbindung, durch welchen das nicht absorbirte Gas
nach auſsen geleitet wird.
Tafeln