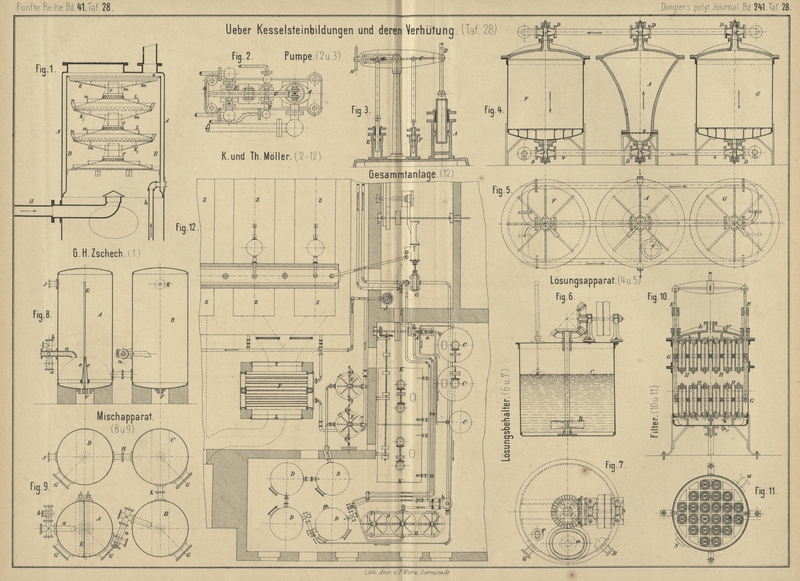| Titel: | Ueber Kesselsteinbildungen und deren Verhütung. |
| Fundstelle: | Band 241, Jahrgang 1881, S. 362 |
| Download: | XML |
Ueber Kesselsteinbildungen und deren
Verhütung.
Mit Abbildungen auf Tafel 28.
(Fortsetzung des Berichtes von S. 202 Bd.
239.)
Ueber Kesselsteinbildungen und deren Verhütung.
Nach dem Bericht von Kobus für den
„Hannoverschen Verein zur Ueberwachung von Dampfkesseln“ fanden sich i.
J. 1880 36 Kessel, welche innen durch Rost angegriffen waren, 6 Kessel zeigten
derartige Corrosionen an der Auſsenfläche, 11 Kessel hatten eine Beule in der
Feuerplatte.
Nach dem bezüglichen Bericht des Magdeburger Vereines für d. J.
1880 fand G. Schnackenberg unter 409 Kesseln 4 Fälle,
in welchen die Feuerplatte in Doppelkesseln mit Zwischenfeuerung gefährliche Beulen
in Folge von Kesselsteinbildungen auf den Feuerplatten zeigten. Die Feuerplatte
eines Zweiflammenrohrkessels mit Innenfeuerung hatte gefährliche Risse in Folge von
Magnesia haltigen Ablagerungen; 126 Kessel zeigten innere, 51 äuſsere Corrosionen
(vgl. F. Fischer 1878 230
38). Der neue Zweiflammrohrkessel mit Vorfeuerung einer Brennerei zeigte von innen
schon nach ½jährigem Betriebe Corrosionen bis zu 2mm Tiefe und ergab die Untersuchung, daſs das Speisewasser Magnesia haltig
war und sich durch die Anwendung der E. de Haën'schen Methode Chlormagnesium
gebildet hatte, welches zerstörend wirkte (vgl. 1877 226
94. 642. 1878 227 307. 230 138). Aus gleicher Ursache waren nach F. Schwager 5 andere Kessel innen angefressen; ein
Kessel hatte in Folge von Schlammablagerungen auf der Feuerplatte eine Beule
bekommen.
B. Spiegel und B.
Kreuterblüth in Beuthen, Oberschlesien (D. R. P. Kl. 12 Nr. 13 783 vom 21.
Juli 1880) wollen die Bildung von festem Kesselstein dadurch hindern, daſs sie dem
Speisewasser eine Lösung zusetzen von 10g
kohlensaurem Natrium in 500cc Wasser, gemischt mit
50g unter chlorigsaurem Calcium, etwas
Terpentinöl, 10g doppeltkohlensaurem Natrium und
so viel Wasser, daſs 1l Flüssigkeit erhalten wird.
– Die Angabe, daſs bei stationären Kesseln die Zuführung von höchstens 0l,5 für 1cbm
Speisewasser genügt, die Kesselsteinbildung zu verhindern, ist falsch; wohl aber
wird das durch die Zersetzung des unterchlorigsauren Calciums gebildete
unterchlorigsaure Natrium das Rosten der Kesselbleche wirksam begünstigen und ist daher vor Anwendung dieses Mittels
dringend zu warnen.
Ueber die Anwendung des von Cords und Deininger
empfohlenen Eisenvitriols liegen zwei Mittheilungen
vor. Bei Anwendung desselben in einem Kessel des Breslauer Vereines (Mittheilungen aus der Praxis des Dampfkesselbetriebes,
1881 S. 58) gingen die Dampfmaschinen von Tag zu Tag schwerer, bis sie beinahe den
Dienst versagten, und als man dieselben öffnete, fand man Cylinder und Schieber so
verschmiert mit einer Masse von Eisenvitriol nebst Talg und Oel, auch die inneren
Flächen von Rost so angegriffen, daſs eine weitere Fortsetzung des Versuches
unterbleiben muſste. Die aus den Dampfkanälen und unter dem Cylinderdeckel
entnommenen Massen enthielten nach Hulwa:
Feuchtigkeit
2,15
Fett
27,95
Eisenoxyd
61,44
Unlösliches (Sand)
8,46
–––––––
100,00.
Die Bildung des Kesselsteines war dabei keineswegs
gehoben.
Nach gef. Mittheilung (19. März 1881) von A. Büttner und Comp. in Uerdingen wurde bei einem stark inkrustirten
Dampfkessel (Root'sches System) das Cords und Deininger'sche Verfahren zur
Beseitigung des Kesselsteines angewendet. Nach einiger Zeit wurden zwei neue
Siederohre eingesetzt und da zeigte es sich, daſs beide schon nach 15stündiger
Betriebszeit so stark zerfressen waren, daſs sie wieder ausgewechselt werden
muſsten. Die Ausfressungen hatten bei 4mm Tiefe
scharfe Ränder, der übrige Theil der Rohre war stark geröthet. – Daſs Eisenvitriol
das Rosten der Kesselbleche sehr befördern würde, war vorauszusehen (vgl. 1880 237 396).
A. Dervaux in Brüssel (* D. R. P. Kl. 13 Nr. 11 387 vom
4. Mai 1880) verbindet den Dampfkessel mit einem auſserhalb liegenden Schlammsammler, in welchem auch das Speisewasser die
ausgeschiedenen Carbonate absetzen soll.
W. Heine in Zimmerhof-Coswig bei Meiſsen (* D. R. P.
Kl. 85 Nr. 11661 vom 28. Februar 1880) will zur Reinigung des Kesselspeisewassers
dem als Regen niederrieselnden Wasser Dampf entgegen
führen. Als neu an diesem Vorschlage kann nur die Angabe bezeichnet werden, daſs zur
Beförderung des Schlammabsatzes mittels mechanischer Streuapparate gleichzeitig Kalk
zugefügt werden soll.
G. H. Zschech in Indianopolis, Nordamerika (* D. R. P.
Kl. 13 Nr. 12 817 vom 18. August 1880) läſst den Abdampf der Maschine durch das Rohr
H (Fig. 1 Taf.
28) in den Vorwärmer eintreten, während das durch Rohr h zugeführte Speisewasser in dem zwischen den Cylindermänteln A und B befindlichen Raum
aufsteigt und oben über die Kante e in ein Becken K flieſst. Von hier rieselt dasselbe über die gezackten
Ränder und die aufgesetzten Ringe m durch den Stutzen
c auf ein umgekehrtes Becken L, um über dessen ebenfalls mit Ringen n besetzte Fläche wieder in ein zweites Becken K1 zu gelangen u.s.f.,
bis das heiſse Wasser schlieſslich unten abflieſst.
Wie O. Bourjau (1880 237 396), so wollen auch K.
und Th. Möller in Kupferhammer bei Brackwede (D. R. P.
Kl. 12 Nr. 10 893 vom 28. März 1879) Schwefelbarium zur
Reinigung des Speisewassers verwenden; doch leiten sie in das damit
versetzte Wasser Kohlensäure ein, oder führen dem als Regen niederfallenden Wasser
Feuergase entgegen. Der nach der Gleichung CaS + CO2
+ H2O = CaCO3 + H2S entweichende Schwefelwasserstoff wird von den
Feuergasen mit fortgeführt.
Um das bei der Reinigung ausgeschiedene schwefelsaure Barium wieder zu Schwefelbarium
reduciren zu können, scheidet man aus dem Speisewasser zunächst die etwa vorhandenen
Bicarbonate mittels Kalkmilch aus, läſst absetzen, fällt in einem zweiten Behälter
das geklärte Wasser mit
Schwefelbarium und behandelt das abermals geklärte Wasser in einem dritten Behälter
mit Kohlensäure.
K. und Th. Möller
beschreiben ferner eine vollständige Anlage zur Reinigung
von Kesselspeisewasser (* D. R. P. Kl. 12 Zusatz Nr. 12 496 vom 12. Februar
1878), welche in Fig. 2 bis
12 Taf. 28 dargestellt ist.
Die Wasserpumpe A (Fig. 2 und
3) wird durch eine Zugstange B bewegt und
damit gleichzeitig auch die mit dem Balancier C
verbundene Pumpe E für Kalkwasser und F für Sodalösung. Der Hub der Kalkwasserpumpe ist
veränderlich, indem man das Gleitstück G durch die
mittels des Griffrades H bewegte Schraube dem Drehpunkt
des Balancier nähert, oder von ihm entfernt. Der Hub der Sodapumpe ist
unveränderlich angenommen, weil man die Lösung der Soda leicht von verschiedenem
Gehalt herstellen kann. Bei Wässern, die einen schnell wechselnden Mineralgehalt
haben, gibt man dieser Pumpe gleichfalls einen veränderlichen Hub.
Die Vorrichtung zur Lösung des Calciumhydrates mittels Filtration besteht aus einem
Kalkbehälter A (Fig. 4 und
5) mit Siebboden a, auf welchem der durch
die Oeffnung e eingefüllte Kalk liegt. Der Behälter ist
oben durch einen Deckel dicht geschlossen; an dem Boden und an dem Deckel sitzt je
ein Stutzen, auf welchem je ein Zweiweghahn D
aufgesetzt ist. Dieses Lösegefäſs ist durch Rohre oben und unten mit zwei Filtern
F und G verbunden,
welche durch die an den Filtern befindlichen Zweiweghähne D mit einander vereinigt oder von einander abgeschlossen werden können.
Das Wasser tritt zunächst durch das Filter G ein, um
hier den etwa mitgeführten Schlamm abzusetzen, geht dann unten in den Kalkbehälter
und durchströmt den auf dem Siebboden liegenden Kalkbrei. Die mechanisch
mitgerissenen Kalktheilchen werden von dem Filter F
zurückgehalten, so daſs das Kalkwasser unten klar austritt. Hat sich das Filter ganz
mit Schlamm gefüllt, so stellt man die Zweiweghähne D
um, so daſs das Wasser nun in umgekehrter Richtung den Apparat durchflieſst, also
zuerst oben in das Filter F tritt, dann durch den
Kalkbehälter geht, um in den Filter G geklärt zu
werden. Das Wasser löst hierbei den im Filter F
abgesetzten Kalk.
Soll die Kalkmilch durch Absetzen geklärt werden, so wird ein oben geschlossener
Behälter C (Fig. 6 und
7) verwendet, in dessen Deckel sich ein Mannloch a befindet, welches durch einen Wasserverschluſs gedichtet ist. Der
Ablaſsstutzen B ist innen mit einem Sieb versehen und
so hoch angebracht, daſs kein Kalkschlamm mit abflieſst. Der Stutzen im Boden dient
zum Ablassen des Kalkschlammes und der Stutzen G zum
Eintritt des Lösungswassers. Der Kalkbrei kann durch Holzkrücken aufgerührt werden,
oder mittels eines Schraubenrührers R, welcher auf dem
Boden liegt und durch Kegelräder mittels Riemenvorgelege betrieben wird. Zur Erkennung des
Wasserstandes befindet sich auf dem Kalkbehälter ein Schwimmer F, dessen Spitze sich in einem Glasrohr neben einer
Scale auf- und abschiebt.
Der in Fig. 8 und 9
dargestellte Apparat dient zum Mischen der Reagentien mit dem zu reinigenden Wasser
und zum Absetzen des Schlammes aus demselben; er kann allein oder in Verbindung mit
Filtern gebraucht werden. Das zu reinigende Wasser tritt durch das Mischrohr a in das Absetzgefäſs A
ein und mischt sich hier mit der Lösung des ersten Fällungsmittels (Kalkwasser),
welches bei b eintritt. Das gemischte Wasser steigt
langsam auf, flieſst oben über die Scheidewand E, um
demnächst durch das Mischrohr n in das Absetzgefäſs B zu gehen. Unten auf dem Boden des Gefäſses A befinden sich zwei Klappen e, welche, sobald der Schlamm abgeblasen werden soll, niedergelegt werden,
so daſs das abflieſsende Wasser nun gezwungen ist, durch den schmalen Spalt am
Umfang zu strömen und den auf dem Boden liegenden Schlamm durch die Oeffnung F mitzureiſsen. Eine fernere Reinigung gestatten die
Mannlöcher G. In dem Rohr n mischt sich das Wasser mit einem zweiten Fällungsmittel (meist Soda), um
dann im Behälter B in derselben Weise wie im
Absatzgefäſs A aufzusteigen. Gleichzeitig findet hier
ein weiteres Absetzen der entstandenen Niederschläge statt; das zum groſsen Theil
geklärte Wasser tritt oben durch den Stutzen K in das
dritte Gefäſs C ein, um hier langsam herabzusinken und
dabei einen weiteren Theil des Schlammes abzusetzen; es tritt dann endlich unten
durch den Stutzen H in das vierte Gefäſs D, aus dem es oben durch den Stutzen J geklärt abgeleitet wird; unter dem oberen Eintritt-
bezieh. Austrittrohr befindet sich eine Blechscheibe, welche das Wasser zwingt, sich
auf den ganzen Querschnitt gleichmäſsig zu vertheilen, indem es durch den Ringraum
zwischen Blechscheibe und Auſsenwand strömt. Dieser Apparat wird in die Saug- oder
Druckleitung der Pumpe eingeschaltet, welche das zu' reinigende Wasser liefert.
Das Filter (Fig. 10 und
11) enthält eine Anzahl von Röhren H aus
Filz, gebranntem Thon, Kohle o. dgl., welche einzeln durch einen guſseisernen Deckel
mittels je einer Schraube geschlossen sind. Durch das Anziehen dieser Schrauben
gegen die Platten k werden die Rohre unten und oben
wasserdicht geschlossen. An den beiden Böden und Deckeln des Filterbehälters
befindet sich ein Probirhahn r. – Das unreine Wasser
tritt durch den Rohrstutzen M in den Filterbehälter
ein, wird durch die Druckpumpe durch die porösen Rohre gepreſst und tritt geklärt
aus den letzteren in die Räume über und unter den Platten k, um von hier aus durch die am Deckel und Boden befindlichen Rohrstutzen
abgeführt zu werden. Der Schlamm wird von Zeit zu Zeit durch die Oeffnung bei N abgelassen. Um den Schlamm abzuschaben, welcher die
Oberfläche der Filterrohre H belegt, sind zwei eiserne gitterartige
Rahmen G angebracht, welche die Filterrohre
umschlieſsen; diese Rahmen haben Schlitze, in die mit Stulpen von Leder o. dgl.
versehene Ringe seitlich hineingesteckt werden, welche die Rohre abgrenzen. Die
beiden Rahmen sind an den beiden Zugstangen E
befestigt, welche durch Stopfbüchsen im Deckel L
abgedichtet sind.
Bei der Gesammtanlage (Fig. 12)
ist angenommen, daſs aus einem Brunnen und einem Bach mit verschiedenartigem Wasser
dieselbe Reihe von Kesseln Z gespeist werden soll. Das
Brunnenwasser muſs mit zwei Fällungsmitteln, das andere Wasser kann mit einem
Fällungsmittel gereinigt werden. Von den drei Pumpen (vgl. Fig. 2 und
3) entnimmt die Wasserpumpe A das zu
reinigende Wasser aus dem Brunnen, während die beiden Chemikalienpumpen a aus den betreffenden Lösungsbehältern C (vgl. Fig. 6)
saugen. Diese drei Pumpen messen das zu reinigende Wasser und die Lösungen der
Fällungsmittel in einem solchen Verhältniſs ab, wie es die chemische Zusammensetzung
des Wassers fordert. Diese Lösungen vereinigen sich in den Mischern D mit dem zu reinigenden Wasser (vgl. Fig. 8 und
9). Der hier etwa nicht abgesetzte Schlamm wird durch die Filter E (vgl. Fig. 10 und
11) zurückgehalten. Von hier flieſst der gröſste Theil des Wassers durch
den Vorwärmer F, welcher durch die von den Kesseln
abziehenden Feuergase erhitzt wird, nach den zu speisenden Dampfkesseln Z.
Das mit nur einem Fällungsmittel zu reinigende Bachwasser wird durch eine mit der
Dampfmaschine Y verbundene Pumpe G angesaugt. Ein Theil des Wassers wird mittels des
Vertheilungshahnes h durch den Lösungsapparat H (vgl. Fig. 4 und
5) getrieben, während die Hauptmenge des Wassers direct zu den Mischern
D oder dem Absetzbehälter K geführt wird und sich dort mit dem mit Fällungsmitteln gesättigten
Wasser vereinigt. Der gröſste Theil dieses gereinigten Wassers aus den Mischern geht
zum Vorwärmer F. Reicht dieser nicht aus, um
sämmtliches Wasser auf 90 bis 100° zu erwärmen, was für die Zersetzung der
Humussäure erforderlich ist, so wird noch ein zweiter Vorwärmer J eingeschaltet, welcher mittels des abgehenden Dampfes
der Dampfmaschine geheizt wird.
Da das Bachwasser in dem angenommenen Fall häufig starken Verunreinigungen mit Seife
durch überliegende Färbereien und Lehmschlamm durch Hochwasser unterworfen ist, so
sind auſser den aufgeführten Reinigungsapparaten noch zwei Absetzbehälter K angebracht, in welchen sich derartiges verunreinigtes
Wasser mit Kalkwasser vereinigt, um durch die gebildete Kalkseife und das gebildete
Calciumcarbonat den Schlamm niederzureiſsen und gleichzeitig von dem gelösten
Calcium, Magnesium und den Bicarbonaten chemisch zu reinigen. Das trübe Bachwasser
wird nach K durch die nur zeitweise gebrauchte Pumpe A gedrückt und vereinigt sich hier gleichzeitig mit dem
durch die eine Chemikalienpumpe gelieferten Kalkwasser; die andere Chemikalienpumpe
wird während dieser Zeit durch Schlieſsung des Hahnes im Saugrohr abgesperrt.
Selbstverständlich wird gleichzeitig die Saugleitung, welche von der Wasserpumpe zum
Brunnen führt, abgesperrt und die zum Bach führende Saugleitung geöffnet. Das im
wesentlichen geklärte Wasser wird demnächst, durch die Pumpe G abgesaugt, in die Mischer gedrückt und von hier geht es durch die Filter
zum Kessel.
Tafeln