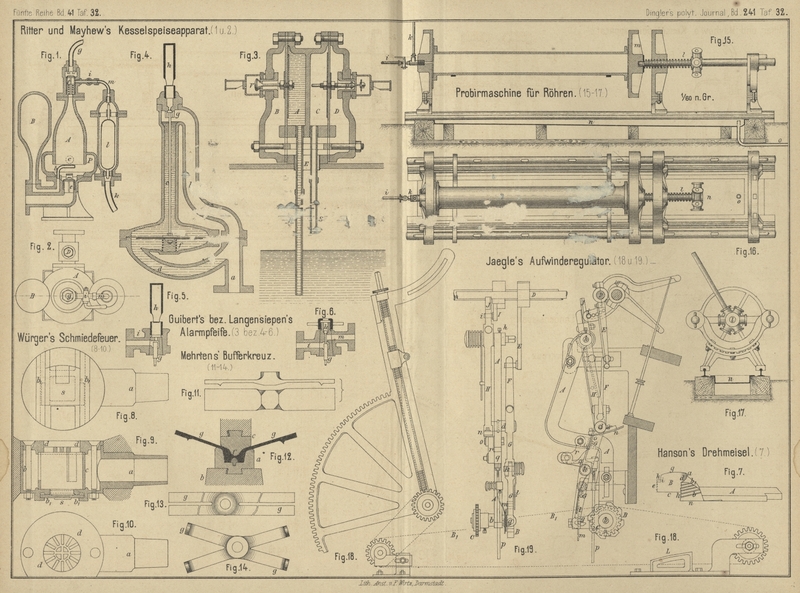| Titel: | L. A. Guibert's und R. Langensiepen's Alarmpfeifen mit Membranvorrichtungen. |
| Autor: | Whg. |
| Fundstelle: | Band 241, Jahrgang 1881, S. 422 |
| Download: | XML |
L. A. Guibert's und R. Langensiepen's Alarmpfeifen mit
Membranvorrichtungen.
Patentklasse 13. Mit Abbildungen auf Tafel 32.
Guibert und Langensiepen's Alarmpfeifen mit
Membranvorrichtungen.
Wenn man ein vom Normalwasserspiegel eines Dampfkessels ausgehendes Rohr in eine über
dem Kessel liegende Kammer münden läſst, so wird die Pressung in derselben verschieden sein,
je nachdem sich der Wasserspiegel über oder unter der Rohrmündung befindet, die
Kammer also mit Wasser oder mit Dampf gefüllt ist; im ersteren Falle ist sie um
einen Betrag, welcher der im Standrohr stehenden Wassersäule entspricht, kleiner als
im zweiten Falle. Ist nun die Kammer auf einer Seite durch eine biegsame Platte
abgeschlossen, welche andererseits durch einen constanten Dampf- oder Wasserdruck
belastet ist, so wird sich die Platte beim Wechsel der Pressung nach der einen oder
anderen Seite ausbiegen und diese Bewegung der Platte kann zu irgend einem Zweck,
z.B. zum Oeffnen eines zur Alarmpfeife führenden Ventiles, benutzt werden. Hierauf
gründen sich die Constructionen von L. A. Guibert in
L'Horme (* D. R. P. Nr. 14 451 vom 30. October 1880) und von R. Langensiepen in Buckau-Magdeburg (* D. R. P. Nr. 14 747 vom 11. Januar
1881).
Die in Fig. 3 Taf. 32 veranschaulichte Construction von Guibert vereinigt zwei Alarmvorrichtungen in sich; die eine zeigt den
Wassermangel, die andere den Wasserüberfluſs an. Jede derselben kann jedoch auch
einzeln für sich ausgeführt werden. Das von der Kammer A ausgehende Rohr R taucht für gewöhnlich in
das Wasser. In Folge dessen ist der Druck in A geringer
als in dem Raum B, welcher durch E stets mit dem Dampfraum des Kessels in Verbindung
steht. Die beide Räume trennende Membran (aus Kautschuk, Leder o. dgl.) wird mithin
nach A hingedrückt und hält das mit ihr verbundene
Ventil V geschlossen. Sinkt der Wasserstand unter die
Mündung von R, so tritt Dampf in A ein, die Pressung wird auf beiden Seiten der Membran
gleich, der auf das Ventil V wirkende Dampfdruck öffnet
dieses und die Pfeife wird zum Ertönen gebracht. – In den Räumen C und D ist für gewöhnlich
Dampf enthalten, der Druck folglich in beiden gleich und das Ventil U wird durch den Dampf auf seinen Sitz gepreſst. Steigt
der Wasserstand bis zur Mündung von S, so füllt sich
C mit Wasser und der nun in D vorhandene Ueberdruck drängt die Membran, welche C von D trennt, nach links, wodurch U geöffnet wird. Die beiden an dem Apparate
angebrachten Pfeifen geben verschiedene Töne.
Langensiepen's Vorrichtung (Fig. 4 bis
6 Taf. 32) hat einen wesentlichen Vorzug vor der vorhergehenden, nämlich
den, daſs die Membran e in ein Rohr cd eingeschaltet ist, welches stets mit Wasser gefüllt bleibt. Die Membran kommt also nie mit dem Dampfe
in Berührung und wird in Folge dessen viel dauerhafter sein als bei der Guibert'schen Einrichtung. Das Standrohr schlieſst sich
an den Stutzen a an. Ist genügend Wasser im Kessel, so
ist auch das Rohr b mit Wasser gefüllt. Die Pressung
ober- und unterhalb der Membran ist, weil auf beide Seiten gleich hohe Wassersäulen
drücken, gleich und das
Ventil g wird durch die Feder f auf seinen Sitz gedrückt. Sinkt der Wasserstand und entleert sich b, so ist der Druck oberhalb der Membran der ganzen in
c und d gebliebenen
Wassersäule entsprechend gröſser als unterhalb; die Membran wird dann nach unten
durchgebogen und das Ventil g geöffnet. Wünscht man zum
Anblasen der Pfeife h trocknen Dampf zu benutzen, so
wird die Einrichtung nach Fig. 5
getroffen. Das Ventil g hat hier die Gestalt eines
Kolbens; der trockene, von einem beliebigen Punkte des Kessels entnommene Dampf
tritt durch i ein.
Dieselbe Membran Vorrichtung, mit dem Aufsatz Fig. 6
versehen, benutzt Langensiepen auch zur Regulirung
seines Speiseapparates (vgl. 1881 241 * 87). Das Ventil
g ist in die zu dem Speiseapparate führende Leitung
im eingeschaltet, welche, von dem Dampfraum oder
besser von dem Wasserraum des Kessels ausgehend, den Zweck hat, nach stattgehabtem
Saugen die zum Oeffnen des Dampf- und des Druckventiles nöthige Spannung im Apparate
herzustellen. Mit dem Ventil g ist in Fig. 6 ein
Luftauslaſsventil k starr verbunden, welches nach
Schluſs des Ventiles g die Luft und allerdings auch
etwas Dampf aus dem Apparate entweichen läſst. Dabei ist angenommen, daſs die Röhre
m an dem höchsten Punkte des Apparates
ausmünde.
Whg.
Tafeln