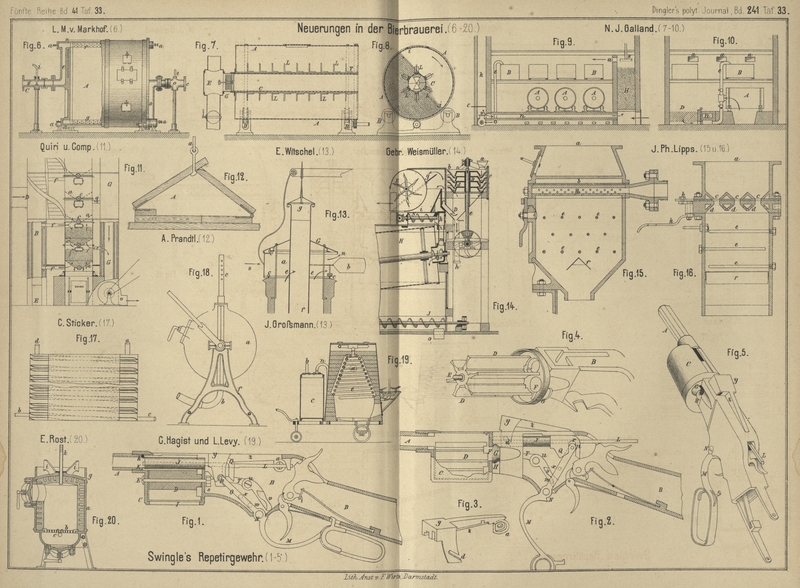| Titel: | Ueber Neuerungen in der Bierbrauerei. |
| Fundstelle: | Band 241, Jahrgang 1881, S. 451 |
| Download: | XML |
Ueber Neuerungen in der Bierbrauerei.
Mit Abbildungen auf Tafel 33.
(Patentklasse 6. Fortsetzung des Berichtes S. 299
Bd. 236.)
Ueber Neuerungen in der Bierbrauerei.
Der rotirende Malzheimapparat von
L. Mautner v. Markhof in Wien (* D. R. P. Nr. 12183
vom 20. April 1880) besteht aus einer Holztrommel A
(Fig. 6 Taf. 33), welche auf rotirenden Walzen ruht und von diesen in eine
sehr langsame Umdrehung versetzt wird. Innen liegen zwei mit feinen Löchern
versehene Rohre g und f,
welche von auſsen durch die verschlieſsbaren Oeffnungen a geputzt werden können. Wird nun an dem Ende c durch das mit g verbundene Rohr o Luft angesaugt, so tritt solche durch Rohr C und e in das Rohr f ein, um fein zertheilt durch die keimende Gerste
hindurch nach dem Rohre g zu strömen. Um die
eintretende Luft anzufeuchten, kann man bei i Wasser
einspritzen. Die Temperatur der abgehenden Luft wird durch das Thermometer t angegeben.
N. J. Galland in Paris (* D. R. P. Zusatz Nr. 11654 vom
2. November 1878 und Nr. 11655 vom 15. März 1879, vgl. 1878 229 255) verwendet jetzt als Keimapparat
einen auf Rollend laufenden Cylinder A (Fig. 7 und
8 Taf. 33) aus gelochtem Blech, in welchem sich ein anderer Siebcylinder
C befindet. 4 oder 6 an die Deckel des Cylinders
A befestigte Längsschienen T sind mit festgenieteten Eisenstangen L
versehen, welche das Keimgut theilen, während dieses durch die drehende Bewegung der
Trommel beständig von i nach j rollt. Der Cylinder C ist zum Zweck der
gleichmäſsigen Lüftung in 4 bis 6 gleiche Abtheilungen getheilt, deren nach dem
Saugkanal E mündende Oeffnungen durch den Drehschieber
G erweitert und verengt werden können.
Die Gesammtanordnung einer pneumatischen Mälzerei zeigen Fig. 9 und
10 Taf. 33. Die in den Quellbottichen B
liegende, mit kaltem Wasser bedeckte Gerste wird nach der erforderlichen Zeit
überrieselt und unter passender, durch das Rohr e
bewirkter Lüftung feucht stehen gelassen. Hierauf läſst man sie in die Keimcylinder
A fallen, welche stündlich 2 bis 4 Umdrehungen
machen. Der Keimraum ist völlig geschlossen; doch kann man durch die Thür auch
äuſsere Luft zutreten lassen, welche dann zusammen mit der aus dem Kanal n kommenden gebrauchten Luft durch den mit Kokes
gefüllten Schacht H geht, hier von dem durch die
gelochten Rohre s vertheilten Wasser gereinigt wird und
durch die Oeffnungen a in den Keimraum gelangt. Von
hier wird die Luft durch das Gebläse v abgesaugt und in
den Kanal k gedrückt, nachdem sie das in den
Keimbehältern A und D
befindliche Keimgut durchstrichen hat, und geht schlieſslich theils durch den
geöffneten Schieber c ins Freie, theils durch den Kanal
n in den Kokesthurm zurück, um den Kreislauf von
Neuem zu machen.
Eine derartige zur täglichen Verarbeitung von 3t
Gerste bestimmte Mälzerei kostet, wie die Allgemeine
Zeitschrift für Bierbrauerei, 1881 S. 207 mittheilt, 70000 bis 80000 M.
Der Keimapparat von Quiri und Comp. in Schiltigheim bei Straſsburg (* D. R.
P. Nr. 12 376 vom 9. Juli 1880) besteht aus einem viereckigen, unten und oben
verschlossenen Thurm, welcher durch Scheidewände a
(Fig. 11 Taf. 33) aus gelochtem Blech in 12 Fächer getheilt ist. Das oben
durch eine verschlieſsbare Oeffnung aufgegebene Keimgut durchläuft diese Fächer von
oben nach unten. Dabei werden in der Mitte der Fächer befindliche Klappen durch die
an Stellrädern c angebrachten Schraubenspindeln
geöffnet. Durch den mit dem Kanal G verbundenen
Luftsauger v wird die von D aus in den Kanal B eintretende Luft durch
die Verbindungskanäle f in die Malzkammern gesaugt,
wobei der Luftzug durch die Zwischenkanäle g mittels
Klappen geregelt werden kann. Auſserdem kann durch den Kanal E warme oder kalte Luft zugeführt werden.
Beim Weichen der Gerste quellen die
untersten Körner bekanntlich deshalb weniger, weil sie sich nicht so leicht
ausdehnen können als die oberen. A. Prandtl erreicht
nun dadurch den gleichen Grad der Quellreife für die gesammte Gerste, daſs er auf
den Boden der Weiche einen hölzernen Rasten A (Fig.
12 Taf. 33) setzt. Nach Ablauf von etwa ⅔ der Weichzeit wird die eine der
beiden Platten mittels Ketten a etwas gehoben, so daſs
die Vorrichtung zusammenfällt und so für die unterste Gerste einen Quellraum frei
macht. – Nach K. Lintner (Zeitschrift für das gesammte Brauwesen, 1881 S. 337) ist diese Vorrichtung
empfehlenswerth.
Die mechanische Mälzerei wird von
F. D. in der Allgemeinen
Zeitschrift für Bierbrauerei, 1881 S. 197 verworfen, weil das Keimgut
während der ganzen Dauer des Processes der Controle entzogen und die Luftzuführung
in den meisten mechanischen Keimapparaten mangelhafter ist als auf der gewöhnlichen
Haufentenne. Der gröſste Fehler sämmtlicher mechanischer Keimapparate ist aber die
Unreinlichkeit. Ist dagegen der Boden einer Malztenne durchlöchert und wird mittels
Luftverdünnung unter demselben die gebildete Kohlensäure entfernt, so hat man die
pneumatische Mälzerei mit Handarbeit in ihrer ganzen Einfachheit, so wie dieselbe
nach Ansicht des Verfassers berufen ist, die Mälzerei der Zukunft zu werden.
Um bei Malzdarren das Zurückdrücken
der abgehenden Wasserdämpfe zu verhüten,. verwendet E.
Witschet in Breslau (* D. R. P. Nr. 13009 vom 10. August 1880) einen Schutzschirm (Fig. 13
Taf. 33), welchen 4 untere und 3 obere Laufrollen c
tragen. Derselbe wird durch das Steuer b so gestellt,
daſs sowohl der von s kommende Wind, als der bei e austretende Wasserdampf bei n entweichen muſs, während der Rauch durch das mit Blechhauben G und g versehene Rohr f abzieht.
Bei der Malzputzmaschine von Gebrüder Weismüller in Frankfurt a. M. (* D. R. P. Nr.
12 962 vom 16. Juli 1880) gelangt das Malz durch den Trichter a (Fig. 14
Taf. 33) in die Abreibevorrichtung, deren Mantel durch conische, innen mit Rippen
versehene, auſsen mit durchlochtem Blechmantel c
umgebene Ringe b gebildet wird, während die Trommel B aus conischen, gerippten, auf der Achse e befestigten Ringen d
besteht. Das von hier nach D gelangte Malz wird mittels
des Ventilators E durch den Kanal f in den Raum i gesaugt,
während Steine u. dgl. durch das Rohr h fallen. Die
Geschwindigkeit des Luftstromes wird durch Klappe g
regulirt. Durch die Schnecke S wird das Malz gegen die
selbstschlieſsende Klappe k gedrückt, fällt durch m und wird durch die Schnecke s in den Cylinder H gebracht, wo es von den
Keimen, die mittels Schnecke J durch o abgeführt werden, gereinigt und dem Ausgang zugeführt
wird.
Um Malz leichter versenden und aufbewahren
zu können, soll man es nach R. Brendergast in Sydney
(D. R. P. Nr. 11422 vom 28. April 1880) quetschen, mit etwas Zucker oder Gummi
versetzen und dann mittels hydraulischer Pressen in eine beliebige Form bringen.
Zum Oeffnen und Reinhalten des Senkbodens
von Maischapparaten empfehlen A. Guérin und
A. Lapotre in Chimay, Belgien (* D. R. P. Nr. 11408
vom 23. April 1880) die Anwendung einer viereckigen, unmittelbar über dem Senkboden
mit dem Rührwerke zusammen in Umdrehung versetzten Welle, welche auf ihren
Seitenflächen mit Kautschukstreifen versehen ist, deren freie Enden bei der Drehung
das Malz auf dem Senkboden ausdrücken und fortschieben.
Das Maischabläuterungsverfahren von
J. A. Topf in Erfurt (* D. R. P. Nr. 10 551 vom 28.
Februar 1880) bezweckt eine völlige Auſschlieſsung der Extract bildenden Stoffe.
Hierzu wird das Malz mittels geriffelter Walzen möglichst fein gemahlen, ferner ein
Theil des Nachguſswassers unterhalb des Senkbodens eingeführt.
Der Vormaischapparat von J. Ph. Lipps in Dresden (* D. R. P. Nr. 11406 vom 24.
März 1880) soll das Malzschrot gleichmäſsig anfeuchten. Das von a (Fig. 15 und
16 Taf. 33) aus zugeführte Malz wird durch die Schlitze c vertheilt, deren Weite sich durch Schieber b mittels des Hebels k
stellen läſst. Zwischen den Schlitzen c liegen die mit
kleinen Löchern versehenen Wasserkanäle d, aus denen
das Schrot beim Herunterfallen von zwei Seiten mit Wasser bespritzt wird. Die im
Innern des Apparates befindlichen Stäbe e dienen dazu,
die so weit hergestellte Mischung von Schrot und Wasser während ihres Falles
wiederholt zu zertheilen, damit die Befeuchtung des Schrotes eine gleichmäſsige
werde. Das eingelegte Winkelblech f theilt dann
nochmals die Masse, ehe sie unten herausfällt.
Luftklärung von J. H.
Reinhardt in Würzburg (* D. R. P. Nr. 11637 vom 6. April 1880) Nach diesem
Vorschlag wird die Luft in Sudhäusern u. dgl. dadurch dunstfrei erhalten werden,
daſs man auf 30° erwärmte Luft eintreibt.
Kühlapparate. Der Apparat von J. Erckmann in Alzey (* D. R. P. Nr. 11839 vom 13. April 1880) besteht aus
einem flachen, mit Wasser gefüllten Kasten, auf dessen Boden ein Schlangenrohr
liegt, welches von der Würze durchflössen wird. – W.
Stavenhagen in Halle (* D. R. P. Nr. 11848 vom 11. Mai 1880) bildet durch
Zusammenlöthen zweier Wellenbleche einen dem Lawrence'schen ähnlichen Flächenkühler
(vgl. 1876 222 * 487).
Der Kühler von C. Sticker in Duisdorf bei Bonn (* D. R.
P. Nr. 13291 vom 4. August 1880) besteht aus einem inneren und einem äuſseren
Cylinder, welche durch zwei in kleinem Abstand von einander angeordnete, ordnete, schraubenförmig
gewundene Bleche mit einander verbunden sind. In die so gebildeten Schraubengänge
tritt die zu kühlende Flüssigkeit bei a (Fig.
17 Taf. 33) ein und bei b aus, die kühlende
tritt bei c ein und bei d
aus.
J. Handwerk in Grimma, Sachsen (* D. R. P. Nr. 12 969
vom 11. Juni 1880) macht den Vorschlag, über den in einem Thurm artigen Gebäude
aufgestellten Kühlschiffen Windflügel zur Beschleunigung der Abkühlung
anzubringen.
O. Fromme in Basel (* D. R. P. Nr. 12705 vom 18. Juli
1880) beschreibt eine Lüftungsvorrichtung an
Bierkellern. In der Mauer zwischen Bier- und Eiskeller wird am Boden eine
mittels Schieber verschlieſsbare Oeffnung und am entgegengesetzten Ende des Kellers
im Scheitel des Gewölbes eine gleich groſse, auch mit Schieber verschlieſsbare
Oeffnung angebracht, welche in einen Kanal mündet, der über das Gewölbe hinweg in
den Eiskeller führt. Liegen zwei oder mehrere Keller über einander, so wird von der
Oeffnung im Gewölbe des untersten Kellers an der Kanal mit gleichem Querschnitt
durch die oberen Keller aufwärts und über dem obersten Gewölbe zurück nach dem
Eiskeller geführt.
Pichapparate. J. Groſsmann in Dresden (* D. R. P. Nr.
11847 vom 8. Mai 1880) verwendet einen guſseisernen, innen mit Chamotte
ausgekleideten Ofen a (Fig. 18
Taf. 33), in welchen unten das Windleitungsrohr b, oben
das Blasrohr c mündet, durch welches die heiſse
Verbrennungsluft in das darüber gesetzte Faſs geleitet wird. Die Vorrichtung ist auf
Lagerböcken f drehbar angeordnet.
C. Hagist und L. Levy in
Dortmund (* D. R. P. Nr. 12758 vom 18. Juli 1880) setzen auf einen Wagen einen
gemauerten, mit Eisenblech umgebenen Ofen zum Ueberhitzen von Wasserdampf in einer
Rohrschlange e (Fig. 19
Taf. 33). Die Feuergase entweichen seitlich durch einen Stutzen a. Der in einem Dampfkessel erzeugte Dampf tritt durch
das Rohr b zur Abscheidung des Wassers in den Behälter
c, dann durch Rohr n
zur Heizschlange, welche in seitlich gelochte Düsen g
endigt. Wird nun ein Faſs mit dem Spundloch über diese Düsen gestülpt, so öffnet
sich der Dampfauslaſshahn derselben.
E. Rost in Dresden (* D. R. P. Nr. 12215 vom 19. Mai
1880) verwendet ein guſseisernes, innen mit feuerfester Masse bekleidetes Gehäuse
a (Fig. 20
Taf. 33), unter dessen Rost b durch Rohr c Luft eingeblasen wird, welche dann durch das Rohr k in die auf Rippen i
gestützten Fässer tritt. In dem Aufsatz g wird das Pech
geschmolzen.
Tafeln