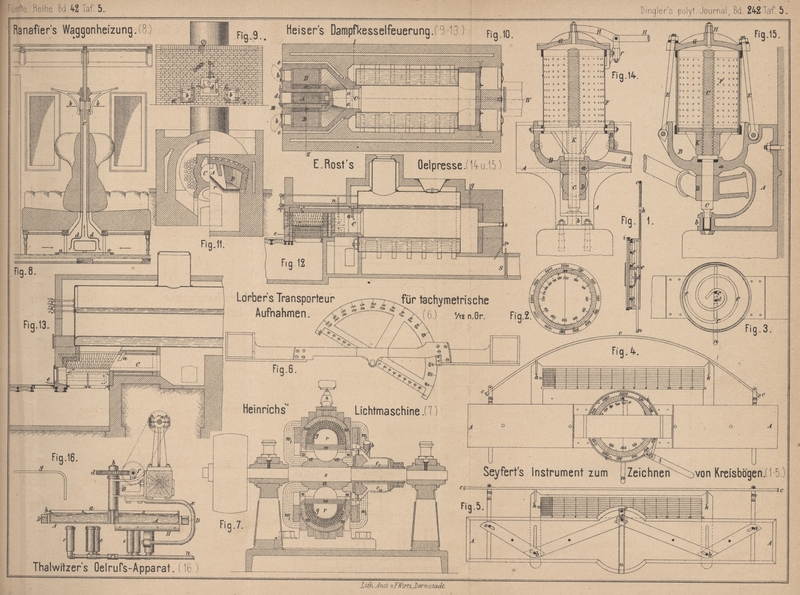| Titel: | H. Seyfert's Instrument zum Zeichnen von Kreisbögen. |
| Fundstelle: | Band 242, Jahrgang 1881, S. 36 |
| Download: | XML |
H. Seyfert's Instrument zum Zeichnen von
Kreisbögen.
Mit Abbildungen auf Tafel 5.
Seyfert's Instrument zum Zeichnen von Kreisbögen.
Zum Zeichnen von Kreisbögen, für welche auch der Stangenzirkel nicht mehr ausreicht,
hat H.
Seyfert in Rochlitz, Sachsen (* D. R.
P. Kl. 42 Nr. 10573 vom 30. Januar 1880) ein Instrument hergestellt, welches im
Wesentlichen aus einem Stahlblättchen c (Fig.
1 bis 5 Taf. 5)
besteht, das an beiden Enden bei m unterstützt und
durch Druck auf zwei zwischenliegende Punkte k nach
Bedürfniſs ausgebogen wird. Die Ausbiegung erfolgt nach einem Kreisbogen, da der
Krümmungshalbmesser der elastischen Linie eines prismatischen Stabes zwischen zwei
in gleicher Entfernung von den Auflagerpunkten wirkenden Einzellasten constant ist.
Die Auflagerstützen m und die Druckstützen k werden gleichzeitig in entgegengesetzter Richtung
verschoben; sie sind in einem Kästchen A geführt,
dessen Inneres die Vorrichtung zum Verschieben der Stützen birgt. Diese Vorrichtung
besteht aus vier doppelarmigen, an den Enden mit Langlöchern versehenen Hebeln; in
die Langlöcher greifen die in den Stützen befestigten Stifte a und b, sowie ein Stift d ein, welcher in dem Schieber n steckt. Ein zweiter Stift e dieses
Schiebers tritt durch einen Schlitz des Gehäusedeckels bis an eine in einer Nuth des
Gehäusedeckels drehbaren Scheibe, welche an ihrer unteren Fläche mit einer
aufgesetzten Spirale f (Fig. 3)
versehen ist. Um die Scheibe ist eine Differentialbremse i (Fig. 4)
gelegt, deren Hebel nach dem Festziehen der Bremse als Handhabe zur Drehung der
Scheibe dient. Bei dieser Drehung gleitet der Stift c
an der Spirale f, der Schlitten n wird demnach verschoben und diese Verschiebung auch auf die Stützen m und k übertragen. Die
Gröſse dieser Verschiebung hängt von der Drehung der Scheibe ab, welche demnach auch
dem Krümmungsradius des Stäbchens e proportionirt ist.
Um diese Drehung beobachten zu können, ist die obere Fläche der Scheibe mit einer
Kreistheilung (Fig. 2)
versehen, gegen welche ein Zeiger o einspielt. Bei den
Theilstrichen sind die der Krümmung des Stäbchens c
zukommenden Radien bemerkt. Die Theilung ist doppelt: am äuſseren Umfang sind der
einmaligen Drehung der Scheibe entsprechend die Radien von 5000 bis 300mm angegeben, auf dem inneren Umfang die bei
weiterer Drehung der Scheibe erzielbaren Radien bis herab zu 150mm.
Tafeln