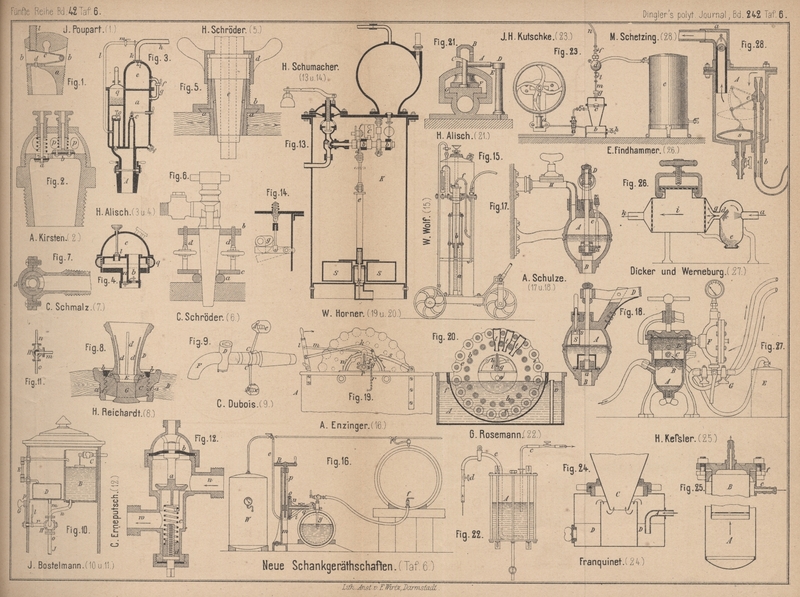| Titel: | Ueber neuere Schankgeräthschaften. |
| Fundstelle: | Band 242, Jahrgang 1881, S. 46 |
| Download: | XML |
Ueber neuere Schankgeräthschaften.
(Patentklasse 64. Fortsetzung des Berichtes S. 202
Bd. 239.)
Mit Abbildungen auf Tafel 6.
Ueber neuere Schankgeräthschaften.
Gährspunde. J. B. J. Poupart in Paris (* D. R. P. Nr. 10439 vom 6. Februar 1880) befestigt in der
Aushöhlung b (Fig. 1 Taf.
6) seines Spundes a eine Feder c, welche je nach der Stellung der kleinen Schraube l das Gummiventil d mehr
oder weniger fest auf seinen Sitz festdrückt.
M.
Gerner in Rostock (* D. R. P. Nr. 12366 vom 25. Juni 1880) drückt gegen die
Ventilöffnung seines Gährspundes eine Gummiplatte durch einen Hebel mit
verstellbarem Gewicht.
N.
Schäffer in Breslau (* D. R. P. Nr. 11625 vom 17. August 1879) hängt auf die
Oeffnung eine durch Metallringe beschwerte Klappe.
Nach A.
Kirsten in Berlin (* D. R. P. Nr. 10430 vom 11. Januar 1880) entweicht die
entwickelte Kohlensäure durch das Ventil b (Fig.
2 Taf. 6) und die Oeffnungen p. Wird dagegen
das Bier abgezapft, so tritt durch das Ventil a eine
entsprechende Menge Luft ein.
Nach H. Alisch in
Berlin (* D. R. P. Nr. 13113 vom 27.
August 1880) strömen die Gährungsgase vom Faſs aus durch Spund A (Fig. 3 Taf.
6) und Ventil c nach dem Behälter a, treten bei geöffnetem Hahn f des Rohres g nach dem Behälter e, von hier durch die mit Ventil k verschlieſsbare Oeffhung i und Rohr h nach einem gemeinschaftlichen
Sammelbehälter. Nach Beendigung der Gährung wird f
geschlossen, der Hahn m geöffnet und es strömen die
gesammelten Gase durch l nach dem Faſs zurück. Bei
nicht genügendem Druck läſst man Luft, welche durch die in q befindlichen Reinigungsmittel gestrichen ist, durch das Ventil o eintreten, wenn das Bier abgezapft wird.
Bei der in Fig. 4 Taf.
6 veranschaulichten Vorrichtung entweicht die Kohlensäure durch Ventil b zum Sammelraum e und
tritt beim Abzapfen durch Ventil l und n wieder ein. Die etwa erforderliche Luft muſs zunächst
die Salicylwatte in dem ringförmigen Wulst q
durchstreichen, bevor sie durch das Ventil n in das
Faſs eintreten kann.
Zur Verbindung zwischen Faſsbüchse und
Zapfhahn ist nach H. Schröder in Fredenbaum bei Dortmund (* D. R. P. Nr. 12750 vom 30. Mai
1880) die Spundscheibe a (Fig. 5 Taf.
6) auf einen Theil des Umfanges abgeschrägt und wird darauf nach Art eines
Bajonnetverschlusses die Büchse b befestigt. Dann setzt
man den mit der Gummihülse c versehenen Hahn e ein und dichtet ihn durch Andrehen der Mutter d.
Zapfhähne. Um das Bier beim Abzapfen aus dem Fasse auch
ohne Spritzhahn zum Schäumen zu bringen, befestigt W. Krüger in
Berlin (* D. R. P. Nr. 12170 vom 11.
Juni 1880) eine durchlöcherte Scheibe in der Ausströmungsöffnung des
Kükens. – H. Steinbrück in Corbach (* D. R. P. Nr. 12002 vom 11. Mai 1880) will einen Zapfhahn
aus Holz mit elastischer Einlage und F. Konrad in
Würzburg (* D. R. P. Nr. 12724 vom 2.
März 1880) einen solchen herstellen, bei welchem durch eine einzige
Umdrehung einer Hülse ein Gummicylinder die Ausfluſsröhre verschlieſst.
Nach C.
Schröder in Dortmund (* D. R. P. Nr. 12433 vom 6. Juli 1880) wird der mit Gummiring
a versehene Hahn (Fig. 6 Taf.
6) fest in das Zapfloch eingeschlagen. Dann legt man die zweitheiligen Scheiben b und c um und zieht die
Schrauben d an, so daſs der Gummiring a die Dichtung des Hahnes im Faſsboden bewirkt.
C.
Schmalz in Nordhausen (* D. R. P. Nr. 12731 vom 15. Juni 1880) hat einen Metallfaſshahn mit Korkeinlage dahin verbessert, daſs
man die Korkeinlage c (Fig. 7 Taf.
6) bequem auswechseln kann, sobald man den Deckel d
abschraubt.
Nach H.
Reichardt in Bayenthal bei Köln (*
D. R. P. Nr. 12792 vom 4. Mai 1880) wird mittels des
cylindrischen scharfen Gewindes a (Fig. 8 Taf.
6) die Spundbüchse A in die Spunddaube B eingeschraubt. Dieselbe hat in ihrem Innern ein cylindrisches
Kordelgewinde, welches den mit entsprechendem Gewinde versehenen Spund C aufnimmt. Letzterer ist in der Mitte durchbohrt und
wird durch einen Kork G verschlossen, der sich bei
einem Druck von innen noch fester setzt, beim Einführen eines Hahnes jedoch leicht
nach innen gestoſsen werden kann. Der obere Theil des Spundes C ist conisch geformt und paſst in die Spundmutter A, gegen welche derselbe mittels des Dichtungsringes
b abgedichtet wird. Bei o ist der Spund C im Innern conisch
ausgearbeitet zur Aufnahme des Dichtungsringes E und
des denselben festhaltenden Futters D, welches infolge
der Schlitze d federnd in die Rinne o greift. Der Hahn wird durch das Futter D eingestoſsen, drückt den Kork nach innen und dichtet
durch den Ring E unter gleichzeitiger Pressung des
Futters D sowohl gegen den Spund C, als auch gegen den Dichtungsring E selbst.
Um ein unbefugtes Entnehmen von
Flüssigkeit zu verhindern, befestigt C. Dubois in
Paris (* D. R. P. Nr. 13042 vom 27.
August 1880) an den Zapfhahn F (Fig.
9 Taf. 6) mit durch Schlüssel drehbarem Conus D zwei in Gelenken C drehbare Arme, welche
Metallkapseln A und B
tragen, deren offene Seiten die halbe Rundung des Conus und des Hahnes überdecken
können. Bedeckt nun Kapsel A das obere, B das untere Ende des Conus, so verbindet man die Ringe
e durch ein einfaches Vorhängeschloſs. – R Herbig
und Comp. in Berlin (* D. R. P. Nr. 12651 vom 14. Juli 1880) verbinden zu gleichem
Zweck den Hahn mit einer Sicherheitsschloſs ähnlichen, ausrückbaren Sperrvorrichtung
zwischen Hahnkegel und Hahngehäuse.
Bei der Meſsvorrichtung zum Abzapfen von
Bier u. dgl. von J. Bostelmann in
Hamburg (* D. R. P. Nr. 13044 vom 9.
September 1880) füllt sich der Behälter B
(Fig. 10 und 11 Taf. 6)
selbstthätig durch den Schwimmerhahn C mit der
Flüssigkeit. Das geschlossene Gefäſs D, dessen
Rauminhalt der zu verzapfenden Maſseinheit entspricht, ist durch Rohr m mit dem Dreiweghahn H
verbunden, welcher durch Rohr n mit B und durch Rohr o mit
einem Abzapfrohr J in Verbindung steht Das Küken des
Hahnes H ist durch die Achse r mit einem Handgriff O verbunden, welcher an
einer Anschlagschiene p nach links oder rechts
übergelegt werden kann.
Sobald man den Griff G nach links dreht, ist die
Verbindung zwischen B und D hergestellt, dagegen nach D und J abgesperrt; die Flüssigkeit steigt von B durch die Rohre n und
m aufwärts, füllt das Maſs D und erscheint im Glase E in Höhe der in B befindlichen Flüssigkeit. Sobald man nun den Griff
G nach rechts überlegt, wird die Verbindung
zwischen B und D
abgesperrt, dagegen die zwischen D und J hergestellt und die Flüssigkeit tritt aus D durch das Abzapfrohr J
aus, wobei sich auch das Standglas E leert. Mit der
Doppelbewegung des Hebels
G wird die gemessene Maſseinheit registrirt, indem
ein an der Achse r befestigter Hebel l auf einen Zählapparat wirkt.
Das Bierdruckregulirventil von C.
Erneputsch in Dortmund (* D. R. P. Nr. 13108 vom 8. Juni 1880) für durch
Wasserleitung betriebene Druckapparate wird in die Wasserabfluſsleitung
eingeschaltet. Der Raum über der elastischen Scheibe b
(Fig. 12 Taf. 6) steht mit dem Windkessel in Verbindung. Die mit dem
Ventil a verbundene Feder c wird mittels der Mutter d so eingestellt,
daſs sie das Ventil hebt, so lange der Bierdruck nicht auf voller Höhe ist. Sobald
dies aber eintritt, überwiegt der Druck auf die Scheibe b und das Ventil unterbricht den von n nach
w gehenden Wasserabfluſs.
H.
Schumacher in Köln (* D. R. P. Nr. 13695 vom 31. October 1880) beschreibt einen
anderen durch Wasserdruck wirkenden Apparat. Das Druckwasser tritt durch das
geöffnete Ventil a (Fig. 13 und
14 Taf. 6) in den Behälter K und preſst die
darin vorhandene Luft nach dem Ort seiner Bestimmung. Mit steigendem Wasserspiegel
hebt sich auch der Schwimmer S, bis er schlieſslich
auch die Steuerstange e hebt und dadurch mittels des
Hebels d eine Drehung der Achse b bewirkt. Dabei steigt das Gegengewicht C
und erreicht nach ⅛ Drehung seinen höchsten Stand. Erst wenn das Gegengewicht über
den höchsten Punkt gegangen ist und anfängt, durch seine Schwere mitzuwirken, zieht
die Steuerstange e das Abfluſsventil k auf, während der Hebel f
den Schluſs des Ventiles a vermittelt. Gleichzeitig
öffnet der Daumen g das Lufteinlaſsventil h, so daſs die Entleerung des Behälters stattfinden
kann. Hat der Schwimmer seinen höchsten Punkt erreicht, so wirkt er durch Anschlag
wieder auf die Steuerstange, welche unter dem Gewichte des Schwimmers eine verticale
Bewegung nach unten macht, hierdurch das Wasserabfluſsventil schlieſst und wieder
die Achse b zurückdreht. Durch diese Zurückdrehung wird
das Luftzuführungsventil h geschlossen und gleichzeitig
das Ventil a geöffnet, so daſs neuerdings Wasser
zuströmen kann.
Zur Druckregulirung an
Spundapparaten schaltet W. Wolf in
Heidelberg (* D. R. P. Nr. 12801 vom
24. August 1879) zwischen Kohlensäureapparat und Bierfässern ein mit
Quecksilber gefülltes Rohr a (Fig. 15
Taf. 6) ein, in welches ein verschiebbares, von der Kohlensäureleitung abgezweigtes
Rohr f eintaucht. Entsteht nun im Entwicklungsapparat
ein zu starker Druck, so wird das Quecksilber von a
theilweise nach oben in das Rohr b gedrückt und die
Kohlensäure entweicht, bis der richtige Druck wieder eingetreten ist und das
Quecksilber nach a zurücktritt.
Mittels des isobarometrischen
Abfüllapparates von L. A. Enzinger in
Worms (* D. R. P. Nr. 12435 vom 11.
Juli 1880) soll Bier aus dem gespundeten Lagerfaſs unter demselben Druck auf die
Versandfässer abgefüllt werden. An einer Säule m (Fig.
16 Taf. 6) kann in einer Führung der Schlitten o mittels der Spindel p auf- und abbewegt
werden. Der Hahn c ist an dem Arm q so mittels einer Schraube befestigt, daſs der Hahn in
wagrechter Richtung gedreht werden kann. Der Arm q
läſst sich in der Büchse des Schlittens o aus- und
einschieben; ferner ist diese Büchse um eine senkrechte Achse u drehbar, so daſs der Hahn c leicht genau über die Spundöffnung gebracht werden und die in einer
Stopfbüchse gehende Röhre y in das Faſs eingesenkt
werden kann. Man drückt nun den Hahn c durch das
Handrad R herab, bis das Spundloch durch den Conus des
Hahnes dicht geschlossen ist. Dann läſst man durch Oeffnen des Hahnes Luft aus dem
Windkessel W in das Versandfaſs eintreten, bis der
Druck dem im Lagerfaſs gleich ist, und öffnet dann den Bierhahn f. Die beim Einflieſsen des Bieres verdrängte Luft geht
durch den Schlauch e in das Lagerfaſs zurück. Zeigt
sich das Bier in der Glasröhre f, so schlieſst man den
Hahn c, hebt ihn heraus und verspundet das Faſs.
In entsprechender Weise soll das Bier auch auf Flaschen gefüllt werden.
Zum Ausschank moussirender Getränke
empfiehlt C. A. Schulze in Leipzig (* D. R. P. Nr. 12429 vom 8. Mai 1880) die in Fig. 17 und
18 Taf. 6 skizzirte Vorrichtung. Oeffnet man den die Leitung des
Mineralwassers abschlieſsenden Hahn H, so tritt das
Wasser in das Gefäſs A ein und verdrängt die in
demselben befindliche atmosphärische Luft durch die unverschlossene kleine Oeffnung
s. Wenn eine bestimmte Menge Flüssigkeit
eingeströmt ist, so hebt dieselbe den Schwimmer S und
schlieſst die Oeffnung s. Da nun die noch im Gefäſs A befindliche atmosphärische Luft nicht mehr entweichen
kann, so wird der gewünschte Druck erzielt, indem die Spannung des Mineralwassers,
die im Ballon herrscht, durch die Leitungsröhre auch auf das im Gefäſs A sich befindende Mineralwasser übertragen wird. Soll
die Flüssigkeit in das Glas abgelassen werden, so wird der Hahn H geschlossen und der Hebel D niedergedrückt. Infolge dessen wird die die Ausfluſsöffnung B verschlieſsende Gummischeibe a gehoben, gleichzeitig aber auch die Luftzufluſsöffnung c geöffnet, so daſs von neuem atmosphärische Luft in
das Gefäſs treten kann. – Was mit dieser Vorrichtung bezweckt wird, ist nicht
angegeben.
Der Flaschenspülapparat von G.
Zimmermann in Elbing (* D. R. P. Nr. 12446 vom 13. Juni 1880) besteht aus einem mit
zahlreichen Fächern zur Aufnahme der Flaschen versehenen, über einem Wasserbehälter
drehbaren Körper. Auf der rechten Seite werden die Flaschen seitlich
hineingeschoben, auf der linken Seite wieder herausgenommen. Dadurch, daſs rechts
mehr Fächer und Flaschen gefüllt sind als links, erfolgt die Drehung des Körpers,
wodurch die rechts hineingesteckten leeren Flaschen nach und nach in den mit Wasser
gefüllten Bottig gelangen und sich hier mit Wasser füllen. Auf der linken Seite
werden stets ebenso viel gefüllte Flaschen herausgenommen, als rechts hineingesteckt
worden sind.
Bei dem betreffenden Apparate von W. Homer
in London (* D. R. P. Nr. 13666 vom 29.
August 1880) werden die Flaschen t (Fig.
19 und 20 Taf. 6)
mit dem Kopf nach unten in die Abtheilungen e der in
dem Wasserbehälter A sich drehenden Trommel b gesteckt, wobei ein Gitter f die Flaschen vor dem Herausfallen schützt. Das mit den senkrechten Armen
h verbundene Wasserleitungsrohr g, welches in den Führungen i auf- und abgleiten kann, ist mit dem einen Ende eines an einem Bügel des
Behälters drehbar befestigten Winkelhebels j verbunden,
dessen anderes Ende durch die Stange k mit dem
Handhebel l in Verbindung steht. Die Spiralfeder p hält den Hahn o des
Wasserrohres g geschlossen, an dessen Arm q eine Kette r befestigt
ist. Wird nun der Hebel l in der Pfeilrichtung bewegt,
so hebt der Winkelhebel j das Rohr g in die Höhe und dessen Arme h treten in die Hälse der darüber liegenden Flaschen. Durch das Heben des
Rohres g wird die Kette r
gespannt und dadurch der Hahn o geöffnet, so daſs das
Wasser in das Innere der Flaschen hineinspritzt. Das Spülwasser flieſst aus den
Flaschen in die Abfluſsrinne a, oder es kann direct in
den bis zur Höhe des Ueberlaufes v mit Wasser gefüllten
Behälter A fallen. Beim Zurücktreten des Griffes l bewegt der Hebel j das
Rohr g nach unten, die Kette r wird gelockert und die Feder p kann den
Hahn o wieder schlieſsen. Bei der weiteren
Rückwärtsbewegung des Hebels l greift die Klaue m in das Schiebrad n ein
und dreht dieses um einen Zahn weiter, so daſs eine neue Flaschenreihe dem Rohr g gegenüber tritt. Die Sperrklinke s verhindert die Rückdrehung der Trommel.
Bei der Reinigungscontrole von
Bierröhren von H. Alisch und Comp. in Berlin
(Erl. * D. R. P. Nr. 12007 vom 21. Mai 1880) ist der Stift A (Fig. 21
Taf. 6), welcher in der schraubenförmigen Nuth der Hülse B läuft, an dem einen Ende des Führungsbolzen C befestigt und an dem anderen mit einem Auge D versehen, welches mittels einer Plombe an dem Plombenhalter E befestigt werden kann. Der Führungsbolzen C trägt an seinem unteren Ende einen Bund F, durch welchen er so in dem Deckel O gehalten wird, daſs sich der Bolzen frei drehen kann.
Soll der Deckel gehoben werden, so löst man die Plombe und dreht den Stift A in der Nuth an den höchsten Punkt, wodurch der Bolzen
C und mit ihm der Deckel eine Bewegung nach oben
erhält.
Die Vorrichtung zum Reinigen der Luft
für Bierdruckapparate von G. Rosemann in
Bremen (* D. R. P. Nr. 12946 vom 10.
Februar 1880) besteht aus einem etwa 30cm hohen Glascylinder A (Fig. 22
Taf. 6), dessen Endflächen durch Eisenplatten geschlossen sind, durch deren obere das
Luftzuströmungsrohr e und das Luftabströmungsrohr c gehen, während die Bodenplatte noch ein Abfluſsrohr
hat. Soll die Luftleitung ausgewaschen werden, so wird das Ventil d abgesperrt, die Verbindung der Luftleitung mit den
Fässern aufgehoben, der Apparat selbst mit frischem Wasser gefüllt und das für
gewöhnlich in die Höhe gezogene Luftabströmungsrohr bis nahe dem Boden des Cylinders
heruntergeschoben. Oeffnet man jetzt das Ventil d, so
wird das im Apparat enthaltene Wasser durch die Luftleitung hindurchgetrieben.
Bei dem Apparat von J. H. Kutschke in
Groſsenhain, Sachsen (* D. R. P. Nr.
12745 vom 25. August 1880) drückt die Luftpumpe a (Fig. 23
Taf. 6) die Luft in den Behälter b. Die Luft geht nun
durch Ventil c und Rohr m
in die mit Baumwolle gefüllte Kugel d, dann weiter in
den Windkessel e. Ist dieser gefüllt, so schlieſst man
den Hahn l, öffnet Hahn f
und läſst die verdichtete Luft durch Rohr n auf das
Bier wirken. Um den Apparat zu reinigen, entfernt man die Baumwolle aus der Kugel
d und bringt darauf die Luftpumpe a durch ein angeschraubtes Rohr mit einem Gefäſs mit
kochendem Wasser in Verbindung, löst darauf die Kapsel g und stöſst das Rohr m bis auf das Ventil
c herab. Alsdann öffnet man den Hahn h und läſst nun das heiſse Wasser durch den Raum b flieſsen, wodurch eine vollständige Reinigung
desselben erzielt werden soll.
Bei dem Luftreiniger von Gebrüder
Franquinet in Oberhausen a. d. Ruhr
(* D. R. P. Nr. 13036 vom 4. Juli 1880) tritt die Luft
von der Pumpe durch das Rohr A (Fig. 24
Taf. 6) in den mit Sodalösung gefüllten Raum D und geht
dann durch den mit Salicylwatte gefüllten Trichter C
zum Luftkessel.
Nach H.
Keſsler in Oberlahnstein (* D. R. P. Nr. 13424 vom 13. Juli 1880) tritt die zu
reinigende Luft durch Rohr e in das Gefäſs A (Fig. 25
Taf. 6) und von da durch den Siebboden in den mit Salicylwatte gefüllten
Filtereinsatz B, welcher mit seinem Rand in eine
Vertiefung in der Flansche f des Behälters A lose eingehängt ist.
Bei der in Fig. 26
Taf. 6 dargestellten bezüglichen Vorrichtung von E. Findhammer in
Witten (* D. R. P. Nr. 13019 vom 26.
Mai 1880) strömt die von der Luftpumpe durch Rohr a in den Apparat geleitete Luft vor die mit einer Drahtkrone c versehene Platte d,
welche die niedergeschlagenen Oeltheile in den Behälter e ableitet. Die Luft entweicht bei g in die
Trommel i, welche mit Salicylwatte gefüllt ist, und
geht durch Rohr k nach dem Luftkessel.
Nach Dicker und Werneburg in Halle
a. S. (Erl. * D. R. P. Zusatz Nr. 12478 vom 13. Juni 1880) sammeln sich die mit der
Luft fortgerissenen Oeltheile im Räume A (Fig.
27 Taf. 6), der Rest wird von der Baumwollschicht B zurückgehalten. Die Luft gelangt nun von C
aus in den Kessel E, wo sie verdichtet wird. Beim Verschänken des Bieres
geht die Luft nach C zurück, durch die in der
Filterkammer D befindliche Salicylwatte und kommt durch
Reducirventil F und Luftvertheiler G auf das Faſs.
Um das Zurückströmen von Bier in den
Windkessel zu verhüten, bringt M. Schetzing in
Rendsburg (* D. R. P. Nr. 12168 vom
25. Mai 1880) in dem nach dem Bierfaſs führenden Rohr a (Fig. 28
Taf. 6) ein Kugelventil c an. Sollte trotzdem Bier
zurücktreten, so wird sich der am Lufteinführungsrohr b
angebrachte Schwimmer s in dem Gefäſs A heben und das Rohr schlieſsen. Erst nach Entleerung
des Gehäuses A durch den am Boden angebrachten
Ablaufhahn wird der Schwimmer sich in seine vorgeschriebene Stellung begeben und der
Luft den Durchgang durch das Ventil e gewähren.
Tafeln