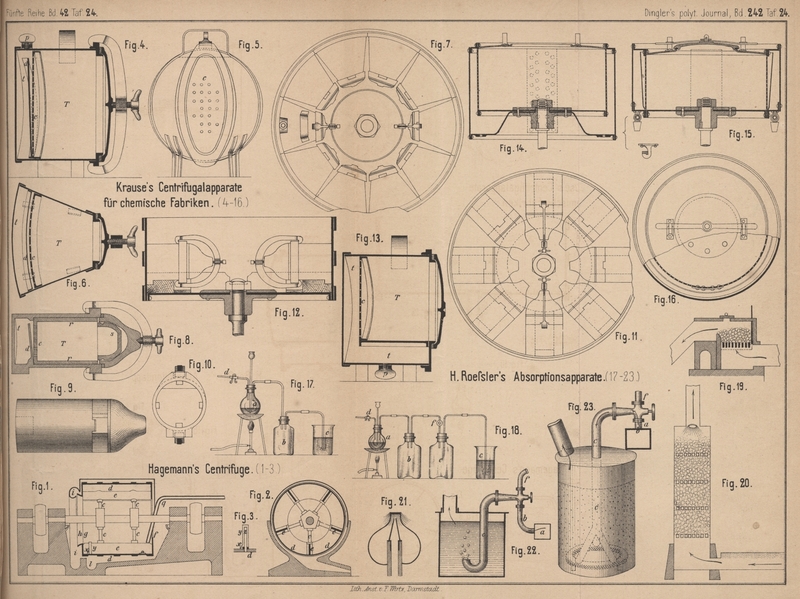| Titel: | Krause's Centrifugalapparate für chemische Fabriken. |
| Autor: | F. H–s. |
| Fundstelle: | Band 242, Jahrgang 1881, S. 276 |
| Download: | XML |
Krause's Centrifugalapparate für chemische Fabriken.
Mit Abbildungen auf Tafel 24.
Krause's Centrifugalapparate für chemische Fabriken.
In chemischen Fabriken stand einer allgemeineren Anwendung der Centrifugalkraft zur
Trennung fester und flüssiger Substanzen bisher der Uebelstand entgegen, daſs das
Constructionsmaterial der gewöhnlichen Centrifugen durch Gemische solcher fester und
flüssiger Körper, welche sauer oder alkalisch sind, angegriffen und deshalb nicht
allein die Maschine selbst zerstört, sondern auch das auszuschleudernde Product
durch die entstehenden Metall Verbindungen verunreinigt wird. Enthalten ferner die
Gemische flüchtige Stoffe, wie Alkohol, Aether u. dgl., so geht ein groſser Theil
der letzteren durch Verdunstung verloren und es bildet sich oft ein
feuergefährliches Gemisch der sehr fein vertheilten ausgeschleuderten Flüssigkeit
mit der umgebenden Luft. Diese Uebelstände werden vollständig beseitigt, wenn nach
dem Verfahren und mittels der Centrifugenapparate von O. H.
Krause in Jersey City, Nordamerika (* D. R.
P. Kl. 12 Nr. 11778 vom 24. Januar 1880) die Trennung der Flüssigkeit von dem
Gemisch erfolgt.
Nach dem neuen Verfahren wird das zu behandelnde Gemisch in die Schleudertrommel
nicht unmittelbar, sondern in dicht verschlossenen Gefäſsen aus Metall, Glas oder
Steingut gebracht, welche so geformt sind, daſs sie bei möglichst geringem Gewicht
und genügender Widerstandsfähigkeit den Raum der Schleudertrommel vortheilhaft
auszunutzen ermöglichen. Die zweckmäſsigste Form ist die in den Fig. 4 bis
6 Taf. 24 dargestellte, da sie, wie die Fig. 7
zeigt, die günstigste Ausfüllung des Trommelraumes ermöglicht; sie ist indeſs nur
bei Metallgefäſsen zulässig, während Gefäſse aus Glas oder Steingut aus
Festigkeitsrücksichten cylindrisch hergestellt (vgl. Fig. 8 bis
10) und in der aus Fig. 11 und
12 ersichtlichen Weise in der Trommel untergebracht werden. Jedes solche
Schleudergefäſs ist durch eine durchlöcherte Wand c in
zwei Kammern T und t
getheilt, wovon die gröſsere T das auszuschleudernde
Gemenge, welches vorher in Tücher oder Säcke aus genügend durchlässigem Gewebe
gepackt wurde, aufnimmt, worauf dieselbe mittels Deckel und Bügel verschlossen wird;
ein Gummiring dient hierbei zur Dichtung. Nach der Beschickung werden die
Schleudergefäſse radial und mit der kleineren Kammer t
nach auſsen in die Centrifugentrommel eingelegt. Bei der Drehung der Trommel wird
die Flüssigkeit durch den gelochten Zwischenboden c
zunächst gegen eine zweite, etwas schräg gestellte Zwischenwand d und an dieser empor gedrängt, bis sie durch die im
oberen Theile dieser Wand angebrachte Oeffnung in den Raum t übersteigt, wo sie nun von dem Gemisch vollständig getrennt ist. Kann
sich bei entsprechender Raumeintheilung die ausgeschleuderte Flüssigkeit nach dem
Abstellen der Centrifuge unterhalb des Füllraumes T
ansammeln (Fig. 13),
so ist die Zwischenwand d entbehrlich.
Bei den cylindrischen Schleuder gefäſsen aus Glas, Steingut u. dgl. kann die
durchlöcherte Wand c lose eingelegt sein, oder sie
kann, wie dies in Fig. 8 Taf.
24 dargestellt ist, zugleich den Boden eines cylindrischen Einsatzgefäſses r bilden. Von solchen Einsatzgefäſsen kann man für
jedes Schleudergefäſs eine Anzahl vorräthig halten, damit sich ein Theil der
Flüssigkeit schon durch Abtropfen durch vorheriges Stehenlassen entfernen läſst. Die
ausgeschleuderte Flüssigkeit wird nach dem Ausheben des Einsatzgefäſses abgegossen;
bei den Metallgefäſsen (Fig. 4 und
13) dient zum Entleeren der Kammer t eine
Ablaſsschraube p. Das in Fig. 8 bis
10 abgebildete Schleudergefäſs enthält noch eine kleine Schale s, welche zur Aufnahme einer Deckoder Waschflüssigkeit
bestimmt ist. Nach dem Einfüllen der letzteren wird die Schale mit einem weniger
durchlässigen Gewebe überbunden und dann erst auf das Schleudergefäſs. aufgesetzt.
Die Fliehkraft treibt die Waschflüssigkeit durch das Gewebe der Schale und den Gefäſsinhalt, welcher
dadurch vollständig von der Mutterlauge befreit wird.
Es ist selbstverständlich nicht nothwendig, daſs alle in eine Schleudertrommel
eingebauten Schleudergefäſse mit denselben Substanzen gefüllt werden; doch soll zur
Vermeidung einseitiger Trommelbelastungen das Bruttogewicht aller Behälter gleich
sein. Reicht die Anzahl der zum Ausschleudern bereit stehenden Behälter nicht zur
gänzlichen Trommelbeschickung hin, so müssen diese symmetrisch in der Trommel
angeordnet, oder es können auch die fehlenden Behälter durch Gegengewichte ersetzt
werden. In solchen Fällen, wo immer das nämliche Gemisch bei hinreichend groſsem
Betriebe zum Ausschleudern gelangt, können die Schleudertrommeln selbst eine den
beschriebenen Schleudergefäſsen ähnliche Einrichtung (Fig. 14 bis
16) erhalten; doch schlieſst, wie schon eingangs erwähnt, ihre Benutzung
die Behandlung solcher Gemenge, welche Metalle angreifen, aus.
Zur Kennzeichnung der Vortheile, welche sich mit diesen Apparaten gegenüber dem
Vacuumfilter erzielen lassen, dient folgender Versuch: Ein steifes Gemisch von
Lävulose und Dextrose (Invertzucker), welches durch Zusatz einer gröſseren Menge
Methylalkohols dünnflüssiger gemacht worden war, lieſs beim Filtriren, während 10
Stunden nur 21,6 Proc. Mutterlauge abflieſsen. Auf dem Filter blieb die sehr
feuchte, noch viel Lävulose enthaltende Dextrose zurück. Ein anderer Theil desselben
Gemisches wurde in ein Preſstuch geschlagen und in dem Centrifugenapparat Fig.
4 bis 7
eine Stunde lang geschleudert. Es schieden sich dadurch
49,5 Proc. Mutterlauge ab, ziemlich trockene, nur noch wenig gefärbte Dextrose
hinterlassend. Auſserdem konnte fast aller in der Mutterlauge enthaltene
Methylalkohol durch Destillation wiedergewonnen werden, wogegen beim Filtriren ein
beträchtlicher Theil des Alkohols durch Verdunstung verloren gehen muſs. Der Versuch
wurde mit einem sehr feinkörnig ausgeschiedenen und in einer zähen Flüssigkeit
suspendirten Präparate ausgeführt. Handelt es sich jedoch darum, gröbere oder gut
krystallisirte Substanzen von ihren Mutterlaugen oder anderen Flüssigkeiten zu
trennen, so wird das Resultat, wie der Erfinder hervorhebt, für die
Centrifugenapparate noch günstiger ausfallen.
F. H–s.
Tafeln