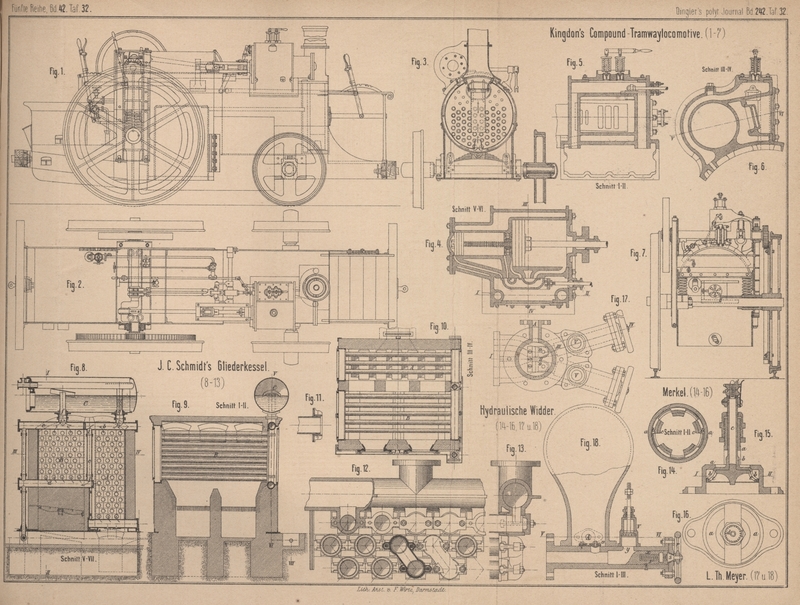| Titel: | J. C. Schmidt's Gliederkessel. |
| Autor: | Whg. |
| Fundstelle: | Band 242, Jahrgang 1881, S. 400 |
| Download: | XML |
J. C. Schmidt's Gliederkessel.
Mit Abbildungen auf Tafel 32.
J. C. Schmidt's Gliederkessel.
Eine neuere Ausführungsform des schon in einem früheren Berichte (1880 238 111) erwähnten Schmidt'schen Gliederkessels ist in den Figuren 8
bis 13 Taf. 32 dargestellt. Dieselbe wird auf den Röhrenwalzwerken von S. Huldschinsky und Söhne in Gleiwitz, Oberschlesien,
ausgeführt. Die Gesammtheit der Röhren zerfällt in zwei Gruppen A und B, in eine vordere,
direct über dem Rost liegende und eine hintere Abtheilung. Die letztere A wird von den Heizgasen in absteigender Richtung durchströmt und dies ist die Haupteigenthümlichkeit
dieses Kessels. Da das Speisewasser in die unterste Röhrenreihe eingeführt wird und
durch die folgenden Reihen in Schlangenwindungen aufsteigt, so ist in dieser
hinteren, als Vorwärmer dienenden Abtheilung eine ausgeprägte Gegenströmung
vorhanden. Die Röhren haben 100mm Durchmesser,
4mm,5 Wandstärke und sind an den Enden durch
Rohrköpfe aus schmiedbarem Guſs nach Art der Root'schen Kessel mit einander
verbunden. Die Dichtung wird durch Asbest hergestellt.
Von den in den betreffenden Patentschriften (Nr. 609 und 1274) dargestellten
Constructionen unterscheidet sich die vorliegende hauptsächlich dadurch, daſs der
Vorderkessel bei jenen mit Dampf gefüllt sein und als Ueberhitzer dienen (hier
jedoch Wasser enthalten) soll und daſs oben ein gröſserer Dampfsammler G aufgesetzt ist, welcher ebenfalls für gewöhnlich noch
zur Hälfte mit Wasser gefüllt sein soll. Das in dem Hinterkessel langsam
aufsteigende und sich allmählich erwärmende Wasser mischt sich in b mit dem aus g von dem
Dampfsammler kommenden Wasser und gelangt mit diesem durch c und d in die untere Röhrenreihe des
Vorderkessels. In diesem wird eine starke Dampfentwicklung und energische Strömung stattfinden und
das Wasser- und Dampfgemisch gelangt dann durch f in
den Dampfsammler, in dem noch ein besonderes Dampfsammelrohr angeordnet ist. Da der
Sammler C nicht geheizt wird, so ist es ungefährlich,
wenn das Wasser aus demselben verschwinden und der Wasserstand selbst bis in die
unteren Röhrenreihen des Vorderkessels sinken sollte. Man wird dann stark
überhitzten Dampf gewinnen können; doch dürfte es mit Rücksicht auf die
Dauerhaftigkeit der direct über dem Feuer liegenden Röhren des Vorderkessels
vortheilhaft sein, den Wasserstand immer im Sammler zu erhalten.
Die äuſsere Reinigung der Röhren kann durch Dampfstrahlen bewirkt werden, die innere
Reinigung, welche hauptsächlich nur im unteren Theil des Hinterkessels nöthig sein
wird, durch häufiges Abblasen und zeitweises Ausbohren. Der nach dem Vorderkessel
mitgerissene Schlamm wird sich theilweise in den durch das Mauerwerk reichenden
Verlängerungen der Rohre d und e ablagern und kann auch von hier bequem abgeblasen werden.
Auf der Berliner Gewerbeausstellung 1879 war ein Schmidt
scher Kessel, für 50e berechnet, in
dauerndem Betriebe. An demselben wurden von E. Brauer
während dreier Tage Verdampfungsversuche angestellt, von deren Ergebnissen die
folgenden Angaben am bemerkenswerthesten sind. Der Kessel war über 4 Monate in
vollem Betriebe gewesen und wurde ohne vorhergehende Reinigung untersucht. Die
Rostfläche betrug 1/40 der Heizfläche, der Zugquerschnitt ¼ der Rostfläche. Als Brennmaterial
wurde oberschlesische Stückkohle benutzt. Wasser, Kohlen, Asche und Schlacken wurden
täglich gemessen, die Temperatur des Speisewassers stündlich, die Temperatur des
Wassers im Kessel, des Dampfes und der Heizgase, wie die Dampfspannung ¼ stündlich.
Man erhielt die nachstehenden Mittelwerthe:
Versuchstag 1879 September
5.
6.
17.
Dauer des Betriebes
Stunden
7,25
7,33
7,5
Temperatur des Speisewassers Grad
14,5
15,0
14,9
„ „ Wassers im Hinterkessel vor
seinem Uebertritt in den Vorderkessel
132,3
158,7
145,5
Temperatur des Dampfes
219,4
197,3
196,4
Dampfdruck k auf 1qc
9,05
9,3
10,4
Zugehörige Temper. des gesätt. Dampſes (nach Fliegner)
179,1
180,2
184,6
Temperatur der Heizgase im Fuchs
220,5
227,9
217,4
Verdampftes Wasser für 1qm Heizfläche
und Stunde k
15,68
16,11
14,32
„ „ „ 1k
brutto verbrauchte Kohle „
8,10
8,00
8,68
„ „ „ 1k
netto „ „ „
8,53
8,40
9,18
Whg.
Tafeln