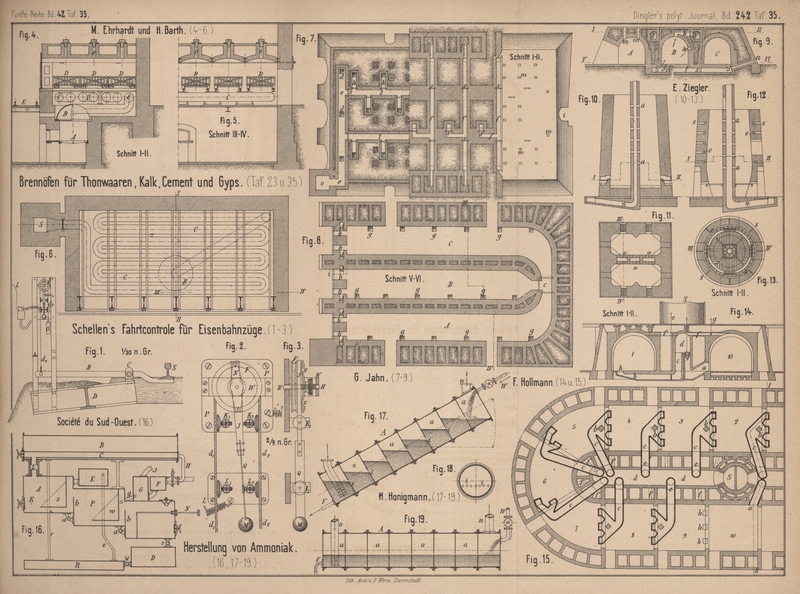| Titel: | Ueber Brennen von Thonwaaren, Kalk, Cement und Gyps. |
| Fundstelle: | Band 242, Jahrgang 1881, S. 427 |
| Download: | XML |
Ueber Brennen von Thonwaaren, Kalk, Cement und
Gyps.
Mit Abbildungen auf Tafel 35.
(Patentklasse 80. Fortsetzung des Berichtes S. 273
d. Bd.);
Ueber das Brennen von Thonwaaren, Kalk, Cement und
Gyps.
Der Gypsbrennofen für ununterbrochenen
Betrieb von M. Ehrhardt in Wolfenbüttel und
H.
Barth in Braunschweig (* D. R. P. Nr. 12284 vom 2. Mai 1880) ist mit einfachen, auf
Trägern ruhenden Kappen abgewölbt. Die auf dem Rost A
(Fig. 4 bis 6 Taf. 35)
entwickelten Heizgase gehen von der Glocke B aus durch
das Schlangenrohr C zum Schornstein S. Ueber diesem Rohrsystem sind Eisenbahnschienen
angebracht, auf denen kleine, 1m im Quadrat
haltende und in ihren Wandungen durchbrochene eiserne Wagen D mit dem zu entwässernden Gyps stehen. Die Beschickung des Ofens wird
mittels einer auf dem Geleise E laufenden Schiebebühne
bewerkstelligt, welche jedesmal 3 Wagen aufnimmt. Die Mündungen des Ofens werden
durch eiserne Thüren verschlossen; die entwickelten Wasserdämpfe entweichen durch
Zuglöcher e.
Der Ziegelbrennofen mit drei Kammern
von G.
Jahn in Berlin (* D. R. P. Nr. 13565 vom 17. August 1880) soll die Vortheile der gröſseren
Oefen auch für kleineren Betrieb ermöglichen. Zu diesem Zweck werden drei je 20 bis
30 Tausend Vollsteine fassende Brennkammern A, B und
C (Fig. 7 bis
9 Taf. 35) bei c verbunden. Die mittlere
Kammer ist von i aus zugänglich. Beim Betriebe wird,
nachdem Kammer A und B
vollgesetzt sind, Kammer A befeuert und B von der abgehenden, bei c eintretenden Hitze vorgewärmt. Es entweichen hierbei die Feuergase aus
B durch die mit Glockenabschluſs versehenen
Rauchabzüge d in den Rauchsammler e und Schornstein o. Ist
A fertig gebrannt, so schlieſst man die Schieber in
c; es tritt eine Pause ein, während welcher Zeit
die inzwischen vollgesetzte Kammer C von der aus der
abkühlenden Kammer A gezogenen Hitze vorgeschmaucht
wird. Die Unterführung heiſser Luft geschieht durch die Kanäle f, welche mit Schiebern s
versehen sind und durch Oeffnungen g in die Kammersohle
münden. Mittels durch die Kanäle n eingelassener kalter
Luft kann man die Temperatur anfangs niedrig halten und dann nach Bedarf steigern.
Die Schmauchgase werden durch Kanäle k in die mit
Schieber z versehenen Schmauchsammler l geleitet und gelangen durch Rauchsammler e in den Schornstein. Ist C gehörig ausgeschmaucht, so wird B befeuert
und C vorgewärmt, in welcher Zeit A entleert und vollgesetzt wird. Hierauf wird A von B geschmaucht,
Vorauf dann in C Feuer und in A Vorfeuer gebracht wird u.s.w. Das Anfeuern geschieht von b aus, worauf dann der ganze Ofenkanal durch Befeuern
von oben mittels der Schürlöcher m in volle Glut gebracht wird, so daſs 3
bis 4 Tage nach dem Anfeuern bei vorangegangenem Ausschmauchen und Vorwärmen der
Brand fertig sein kann.
Um bei Schachtöfen zum Brennen von Kalk
und Cement einen gleichmäſsigen Brand zu ermöglichen, will E.
Ziegler in Heilbronn a. N. (* D. R. P. Nr. 12592 vom 7. Februar 1880) mitten im Ofen
Wände oder Säulen aufführen. Sind dieselben hohl und mit Schlitzen a (Fig. 10 und
11 Taf. 35) versehen und entweder erhöht, oder mit einem Gebläse
verbunden, so werden die Feuergase nach der Mitte zu gesaugt (vgl. Verkonteren 1880 237 * 292).
Flugasche u. dgl. kann von dem Gang n aus entfernt
werden.
Um in Cementschachtöfen die Bildung von Kohlenoxyd zu vermeiden, werden in der
Auſsenwand des Ofens (Fig. 12 und
13 Taf. 35) in verschiedenen Höhen ringförmige Kanäle e angebracht, welche mit der äuſseren Luft durch
verschlieſsbare Oeffnungen s und mit dem Innern des
Ofens durch Schlitze in Verbindung stehen, so daſs überall hin frische Luft
zugeführt werden kann.
Der Ringofen von F.
Hollmann in Berlin (* D. R. P. Nr. 13391 vom 21. Januar 1880) soll dadurch eine
gleichmäſsigere Vertheilung der Hitze erzielen, daſs die Gase nicht wie bisher durch
Seitenöffnungen a (Fig. 14 und
15 Taf. 35) abgesaugt werden – zum Vergleich zeigt Kammer 10 diese Einrichtung –, sondern durch Oeffnungen h in der Sohle, welche unter dem Boden durch drei Züge
b zum Fuchs c mit
Schieber e führt. Um eine Condensation der in den
Feuergasen vorhandenen Wasserdämpfe an den neu eingesetzten Steinen zu verhindern,
sind obere Feuerleitungszüge f mit Schieber g angebracht, welche die Wasserdämpfe in den
Rauchsammler d und Schornstein S abführen sollen.
Tafeln