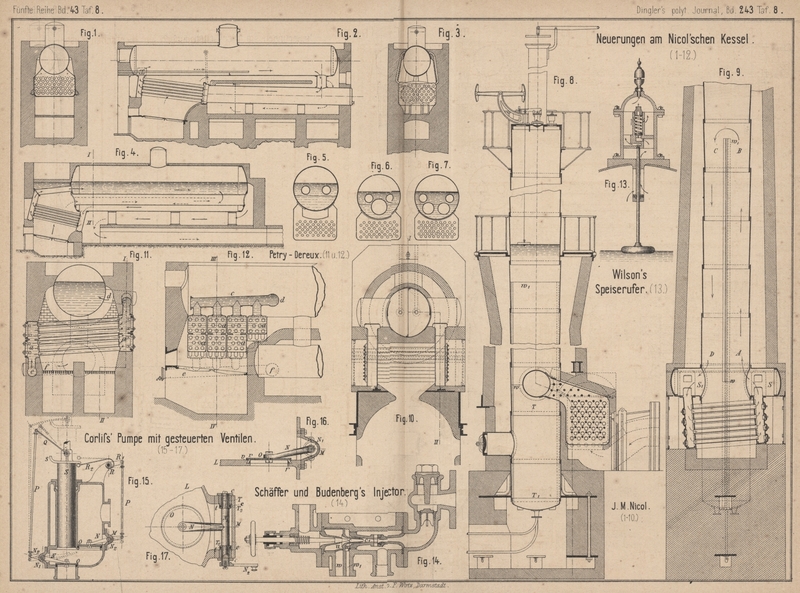| Titel: | G. H. Corliss' Pumpe mit gesteuerten Ventilen. |
| Fundstelle: | Band 243, Jahrgang 1882, S. 95 |
| Download: | XML |
G. H. Corliſs' Pumpe mit gesteuerten
Ventilen.
Mit Abbildungen auf Tafel 8.
Corliſs' Pumpe mit gesteuerten Ventilen.
Um das Schlagen der Pumpenventile zu beseitigen, überläſst G.
H. Corliſs in Providence, Nordamerika (* D. R. P. Kl. 59 Nr. 13891 vom 16. Juni 1880) solche
Ventile nicht sich selbst bezieh. der Rückwirkung des Wassers bei der Umkehrung der
Kolbenbewegung, sondern er bewirkt den Ventilschluſs schon im letzten Theil des
Kolbenhubes durch eine vom Pumpenkolben bethätigte Steuerung; übrigens wird zum
gleichen Zweck der metallische Anschlag bei den Ventilen in bemerkenswerther Weise
vermieden. Die Ventile O (Fig. 15 bis
17 Taf. 8) sind an Hebeln N befestigt, deren
Achsen N1 aus den
Ventilkammern ins Freie treten und hier die Hebel N2 tragen. Bei dem Saugventil ist der Hebel N2 durch die Stange P mit dem am Pumpenkolben angelenkten federnden Hebel
Q verbunden, welcher während des gröſsten Theiles
des Kolbenhubes frei schwingt und lediglich das Ventilgewicht ausgleicht. Erst gegen
das Ende seines Hubes stöſst der Kolben S mit seinem
Ansatz s gegen den Hebel Q, wodurch die Stange P gehoben und das
Saugventil auf seinen Sitz niedergedrückt wird. Die Steuerung des Druckventiles
lieſse sich in gleicher Weise bewerkstelligen; in Fig. 15 ist
jedoch als Ausführungsvariante die Verbindung des Hebels N2 durch die Stange P mit einem steifen Hebel R1 dargestellt, auf dessen Achse R eine starke spiralförmig gewundene Feder R2 befestigt ist. Auch
diese Vorrichtung gelangt erst gegen das Ende der diesmal nach abwärts gerichteten
Kolbenbewegung zur Wirkung, da dann erst die Flansche des Kolbens den Federhebel R2 mitnimmt und dadurch
den Schluſs des Druckventiles hervorruft. Die Ventile müssen zum Schluſs gebracht
sein, wenn der Kolben sein Hubende erreicht hat. Etwaige Adjustirungsfehler sind
durch die Federung der Hebel Q und R2 unschädlich gemacht.
Die Ventilhebelachsen N1 müssen gehörig dicht durch die Ventilgehäusewand treten und doch leicht
drehbar sein. Die Abdichtung ist deshalb nicht durch Stopfbüchsen, sondern in der
aus Fig. 17 ersichtlichen Weise erzielt. Die mit dem Hebel N aus einem Stück hergestellte Achse N1 ist durch genügend
weite Löcher der auf das Ventilgehäuse aufgeschraubten Klappe M geschoben. Hierauf werden auf der Achse N1 die metallenen
Büchsen T warm aufgezogen oder sonstwie befestigt und
dann die Packungsringe t aus vulkanisirtem Gummi gegen
die Büchsenflanschen T2
geschoben, an die Packringe aber noch glatte Ringe e
beigelegt. Schlieſslich werden die Oeffnungen der Kappen M durch die Lagerbüchsen c geschlossen und
dadurch zugleich die Packringe t etwas
zusammengedrückt, weshalb letztere die sich mit der Achse N1 drehenden Büchsen T dampf- und wasserdicht gegen die Lagerbüchsen c abdichten.
Die Ventilsitze sind in eigenthümlicher Weise mit Leder besetzt. In die ziemlich
breite Unterdrehung des Ventilsitzrandes v (Fig.
16) sind nämlich mehrere Windungen von Lederstreifen auf hoher Kante
eingebracht und durch einen eingesprengten, an einer Stelle aufgeschnittenen,
kräftig nach auſsen federnden Metallring r
festgehalten. Die
Lederstreifen müssen so breit sein, daſs die Liderung über die Oberfläche der
Ventilkammerwand L vorragt. Nach dem Einsprengen des
Ringes r wird die Liderung, so weit sie über der
Oberfläche von L vorragt, abgeschnitten; durch das
Feuchtwerden dehnt sich das Leder wieder etwas aus und bildet einen glatten,
gleichförmigen und gerade genügend elastischen Sitz, auf welchen das Ventil O selbst dann geräuschlos sich aufsetzt, wenn es mit
groſser Heftigkeit gegen den Sitz gestoſsen wird. Oefteres Trocken werden soll
erfahrungsgemäſs solchen Sitzen nicht schaden. Uebrigens könnte auch statt des
Ventilsitzes die Ventilplatte O in ähnlicher Weise
gelidert werden.
In einem Zusatzpatent (* Nr. 14790 vom 16. Juni 1880) werden Ringventile für groſse
Luft- und Wasserpumpen angegeben, deren Sitze ebenfalls in der beschriebenen Weise
mit Leder besetzt sind und von denen das Druckventil durch eine Steuerung
geschlossen wird. Die Anordnung dieser Ringventile in einem concentrisch um den
Pumpencylinder gelegten Ventilgehäuse ist zwar sehr einfach, bringt aber die
Unzuträglichkeit mit sich, daſs die Ventile schwer zugänglich sind.
Tafeln