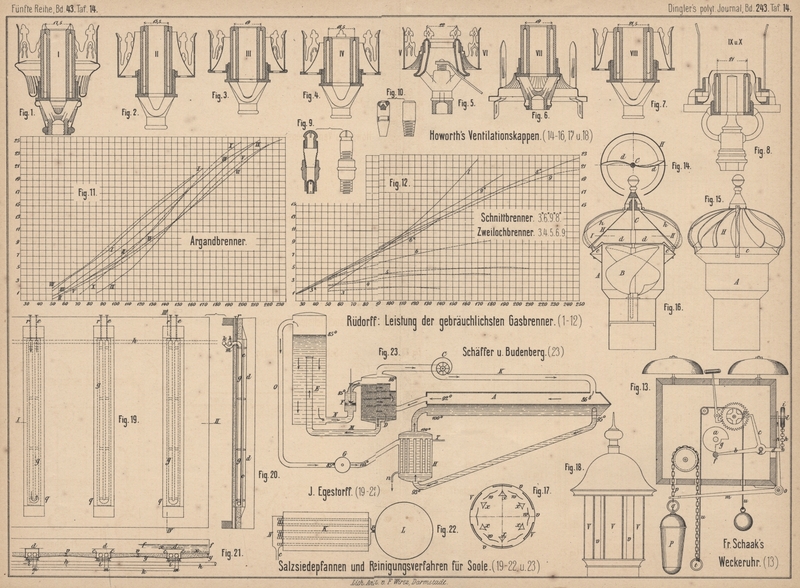| Titel: | Neuerungen an Salzsiedepfannen und Reinigungsverfahren für Soole. |
| Fundstelle: | Band 243, Jahrgang 1882, S. 131 |
| Download: | XML |
Neuerungen an Salzsiedepfannen und
Reinigungsverfahren für Soole.
Mit Abbildungen auf Tafel 14.
Salzsiedepfannen und Reinigungsverfahren für Soole.
J. Egestorff in Hannover (* D. R. P. Kl. 62 Nr. 14782
vom 1. Februar 1881) hat Bodenvertiefungen angenommen, deren Anzahl sich nach der
Gröſse der aus Eisenblech gefertigten Pfannen richtet. In diesen Bodenvertiefungen
q (Fig. 19 bis
21 Taf. 14) liegen die Dampfheizrohre g,
etwa in gleicher Höhe des Hauptpfannenbodens v, und
sind diese Bodenvertiefungen so anzulegen, daſs zwischen dem Dampfheizrohr g und dem Boden derselben ein Zwischenraum von 6cm bleibt. Dieser Zwischenraum hat den Zweck, der
Soole die Wärme von den frei liegenden Dampfheizrohren g besser mitzutheilen und zu verhüten, daſs, wenn beim unvorsichtigen
Arbeiten der Sieder Salz in die Bodenvertiefung kommen lassen sollte, sich dieses
nicht an dem Dampfheizrohr g lagert, sondern tiefer auf
den Boden fällt. Um die Bodenvertiefungen frei von Salz zu halten, sind über
denselben Ueberdachungen d angebracht, welche seitwärts
etwa 12cm über die Vertiefungen hinwegragen, um
das niederfallende Salz, welches sich an der Oberfläche ausgeschieden, über den
Bodenvertiefungen aufzufangen. An beiden Enden sind die Ueberdachungen d, indem dieselben schräg nach dem Hauptpfannenboden
v zulaufen, mit demselben verbunden, um das
Spritzen des Salzes zu verhüten, wenn dasselbe mittels eines Hakens von den
Ueberdachungen d nach der Bordseite der Pfanne gezogen
wird. An der Oberkante der Bodenvertiefungen sind kleine Borde c angebracht, um zu verhindern, daſs das auf dem
Pfannenboden v lagernde Salz beim Entleeren der Pfanne
in die Vertiefung q fällt.
Um der Pfanne die nöthige Festigkeit zu geben, sind unter derselben T-Träger
angebracht und ist auf die Flansche derselben ein Boden y gelegt. Der Raum zwischen Boden y und
Pfannenboden ist mit Infusorienerde, Asche u. dgl. zu füllen, um zu verhüten, daſs
der Pfanne durch kalte Luft Wärme entzogen werde. Unter der Pfanne liegt das
Dampfspeiserohr h, welches in der Verlängerung nach dem
Trockenraum führt. Aus diesem Rohr h werden bei i, bevor man Hahn r
geöffnet, die Dampfheizrohre g gespeist und tritt das
Condensationswasser, ehe man Hahn e geöffnet, bei m in Rohr k, durch welches
das warme Wasser dem Dampfkessel wieder zugeführt wird. Diese Anlage soll den
Vortheil haben, daſs die Pfanne längere Zeit im Betriebe sein kann, ohne einer
Reinigung zu bedürfen, da man immer neue Soole zuführen kann. Um aber keine zu
groſse Menge Soole zu erhalten, ist darauf zu achten, daſs der Flüssigkeitstand f (Fig. 21) in
der Pfanne nicht überschritten werde, so daſs nur die Ueberdachungen d genügend von der Soole bedeckt sind, damit von diesen
das Krystallisiren des Salzes an der Oberfläche nicht gestört werde. Das
niederfallende Salz x wird sich dann auf dem
Hauptpfannenboden v und den Ueberdachungen d lagern.
Die Bodenvertiefungen q gestatten, nur wenig Soole zu
verarbeiten; würden die Heizrohre g sich über dem
Hauptpfannenboden v befinden, so würden die
Ueberdachungen d höher liegen und man würde dann auch
in derselben Höhe so viel Soole mehr in der Pfanne haben; ferner würde man die
Pfanne leeren müssen. Man könnte dann dieselbe nur auf etwa 0m,2 leer sieden und es ginge somit die Wärme der
zwischen den Dampfröhren sich lagernden Soole verloren, was durch die Vertiefungen
q verhindert wird, da man, sobald die Pfanne
ziemlich leer gesotten ist, die kleinen Borde c
entfernt, um dem Rest der Soole die Wärme der Heizrohre g besser mitzutheilen, infolge dessen der ganze Inhalt der Pfanne
versotten wird. Sobald beim Leersieden der Pfanne die Soole unter die Ueberdachungen
d tritt, bringe man dieselbe in der Nähe der
Heizrohre g etwas in Bewegunng, um das sich darauf
lagernde Salz auf den Heizrohren g so viel wie möglich
durch Bewegung der Soole zu entfernen und die Heizkraft durch Ansetzen von
Pfannenstein an den Heizrohren g bis zum gänzlichen
Leersieden der Pfanne nicht zu beeinträchtigen.
Um ein schönes weiſses Salz zu erzielen, soll man den Bottich L (Fig. 22
Taf. 14) mit Soole füllen, dann den zur Reinigung nöthigen Kleberstoff hinzuthun,
den Hahn p öffnen und von hier aus die Soole durch eine
entsprechende Anzahl Siederohre a im Dampfkessel K führen. Man bringt die Flüssigkeit in diesen
Siederohren zum Kochen und öffnet die Hähne a nur so
weit, daſs die Soole im Kochen bleibt und siedend in einen Kasten N läuft. Am Ende dieses Kastens ist vor dem Abfluſsrohr
c, durch welches die Soole der Pfanne zugeführt wird, ein Filter aus
Flanell o. dgl. angebracht, welches die unreinen Theile der Soole absondert.
Nach Schäffer und Budenberg in Buckau-Magdeburg (* D. R.
P. Kl. 62 Nr. 13939 vom 28. September 1880) soll beim Verdampfen von Salzlösungen in geschlossenen Verdampfapparaten A (Fig. 23
Taf. 14) und unter Ueberleiten von Luft aus dem sich bildenden Gemenge von Dampf und
Luft der Dampf durch im Condensator D unter niederem
Druck befindliches Wasser niedergeschlagen werden. Die Luft wird darauf von neuem
durch Ventilator C und Röhre K in den Verdampfapparat gedrückt, während die niedriger siedende
Flüssigkeit aus D durch weitere Druckverminderung im
Gefäſs E zum Verdampfen gebracht wird und die sich aus
ihr entwickelnden, nunmehr gasfreien Dämpfe durch Rohr O und Pumpe G zum Erwärmen der in Kapsel H befindlichen Salzlösung benutzt werden. Das
Condensationsgefäſs D enthält eine Anzahl Siebböden,
durch welche die oben einströmende Flüssigkeit, in möglichst feine Tropfen
zertheilt, nach unten hindurchflieſst, während das unten eintretende Gemisch von
Luft und Dampf gezwungen wird, in mehreren Windungen den Flüssigkeitstropfen zu
begegnen. In das Verdampfungsgefäſs E tritt die im
Condensationsgefäſs D erwärmte Flüssigkeit durch die
Rohrleitung M nahe dem Flüssigkeitsspiegel ein, um bei
N durch Pumpe F wieder
in das Condensationsgefäſs D gedrückt zu werden. Durch
die Wirkung der Pumpe G siedet das Wasser in E bei 85°. Das aus E durch
Pumpe F nach D
übergeführte Wasser kann sich in D durch die
Wärmezufuhr aus der Verdampfpfanne A in Wasser von
höherer Temperatur verwandeln, da in D gegenüber E ein dem Unterschiede der Flüssigkeitshöhen
entsprechender höherer Druck herrscht. Das durch Rohr M
in E zurücktretende Wasser von 87° heizt demnach E und erzeugt eine entsprechende Menge Dampf von 85°.
Dieser Dampf von 85° wird durch Pumpe G abgesaugt und,
indem durch Zusammendrückung seine Temperatur auf 103° gebracht ist, wie beim
Piccard'schen System (vgl. 1879 231 * 211), zur Erwärmung der Salzlösung wieder
verwendet. Um weitere Dampfmengen aus einem Generator oder einer Dampfmaschine zur
Erwärmung zu benutzen, ist eine Rohrleitung T
angebracht. Das Condensationswasser flieſst bei n
ab.
Tafeln