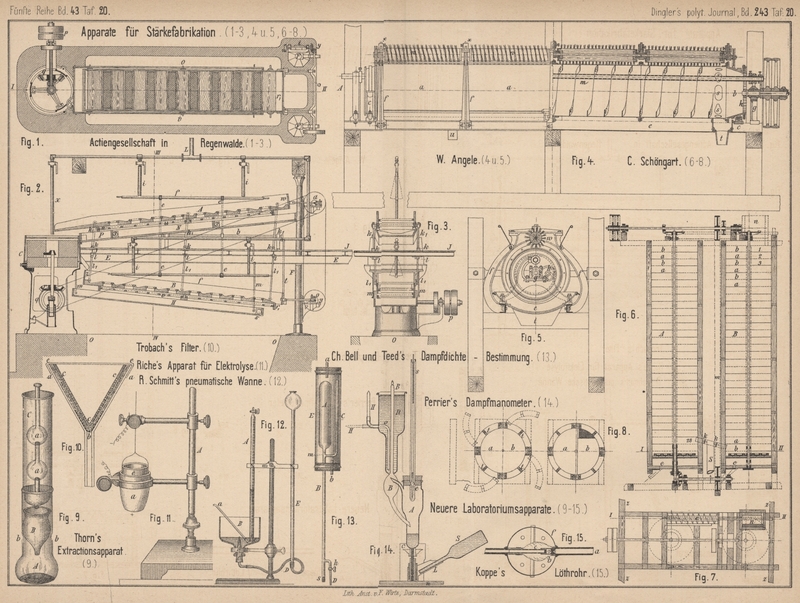| Titel: | Neue Apparate für Laboratorien. |
| Fundstelle: | Band 243, Jahrgang 1882, S. 248 |
| Download: | XML |
Neue Apparate für Laboratorien.
Mit Abbildungen auf Tafel 20.
Neue Apparate für Laboratorien.
Der Extractionsapparat von E. Thorn in Hamburg (* D. R. P. Kl. 12 Nr. 14523 vom
17. October 1880) ist aus Glas hergestellt. Der mit einem Filter ausgekleidete und
mit der auszuziehenden Substanz gefüllte Trichter B
(Fig. 9 Taf. 20) wird von den nach innen vorspringenden Eindrücken b des Gefäſses A getragen,
welches die Extractionsflüssigkeit enthält. Der eingeschliffene Cylinder C ist mit Wasser gefüllt. Man erwärmt nun das Gefäſs
A, so daſs der Dampf der siedenden Flüssigkeit
zwischen den Wandungen des Trichters B und des Gefäſses
A aufsteigt, sich in den Kugeln a verdichtet und in den Trichter B zurückfällt. Ist die Extraction beendet, so hebt man
den Cylinder C ab und bestimmt den Extractgehalt durch
Wiegen des Trichters B oder der ausgetrockneten Flasche
A aus dem Gewichtsverlust oder der
Gewichtszunahme.
Die Filtrirvorrichtung von K. Trobach in Berlin (* D. R. P. Kl. 12 Nr. 15745 vom
2. März 1881) besteht aus einem gewöhnlichen Trichter a
(Fig. 10 Taf. 20), in welchem mittels der federnden Klemme e ein siebartig durchlöcherter Einsatz befestigt ist,
während die Spitze bei b eine Siebkapsel trägt. Der
Zwischenraum zwischen c, a und b ist mit Asbestwolle ausgefüllt.
Zur elektrolytischen Bestimmung von Blei,
Kupfer, Zink und Nickel verwendet A. Riche (Annales
de Chimie et de Physique, 1881 Bd. 13 S. 508) einen gleichzeitig als
positiven Pol dienenden Platintiegel a (Fig. 11
Taf. 20), welcher von einem Stativ mit Glasstange A
getragen wird. Als negativer Pol dient ein unten und oben offener, dem Tiegel sonst
ähnlicher Platinconus e, in dessen Seiten längliche
Oeffnungen eingeschnitten sind, damit während der Elektrolyse eine gleichmäſsige
Concentration erreicht wird. Der Zwischenraum von Conus und Tiegel beträgt 2 bis
4mm. Die Fällung gröſserer Flüssigkeitsmengen
geschieht in einem Becherglase mit eingetauchtem Platincylinder als negative
Elektrode und einem cylindrisch gebogenen Platindrahtnetz als positiven Pol.
Zum Auffangen und Messen von Gasen,
namentlich von Stickstoff bei dessen directer Bestimmung, verwendet R. Schmitt (Journal für praktische Chemie, 1881 Bd. 24
S. 444) als pneumatische Wanne den umgekehrten, abgesprengten Kopf B (Fig. 12
Taf. 20) einer Flasche, in dessen Hals ein langer Gummipfropfen C dicht eingesetzt ist. Zum Auffangen und Messen der
Gase kann jede in 0cc,5 getheilte Glashahnbürette
benutzt werden. Man füllt nun die Wanne mit der betreffenden Flüssigkeit, z.B. mit
Kalilauge, bis 1cm über den Gummistopfen an, so
daſs sich auch das durch Schlauch D mit der Wanne
verbundene Rohr E füllt. Dann setzt man die Meſsröhre
A luftdicht auf den Gummipfropfen und öffnet den
Hahn, so daſs die Füllung derselben durch das Rohr E
bewirkt wird. Man hebt nach Schlieſsung des Hahnes die Gasbürette vom Gummistopfen
ab, senkt sie gefüllt bis auf den Boden der Wanne und läſst durch Neigen der Röhre
E die überschüssige Flüssigkeit bis zur Höhe des
Gummipfropfens abflieſsen. Die Zuleitung des Gases geschieht in gewöhnlicher Weise;
doch wird die Biegung des Gasleitungsrohres a mit einem
Gummischlauch e überzogen, um das Zerbrechen desselben
durch das Meſsrohr zu verhüten. Nachdem das Ueberleiten des Gases, dessen Volumen
bestimmt werden soll, beendet ist, wird die Wanne in der früheren Höhe mit Wasser
gefüllt und das Meſsrohr fest auf den Kork aufgesetzt und so die Verbindung mit dem
Rohr E wieder hergestellt, so daſs dieses jetzt als
Druckregulator dient, indem man durch Senken, Heben desselben oder Nachfüllen die
Flüssigkeit in beiden Röhren in gleicher Höhe einstellt. Hat man Kalilauge als
Absperrflüssigkeit und will die Ablesung des Gasvolumens über Wasser vornehmen, um
die Tension des Wasserdampfes in Rechnung bringen zu können, so gieſst man, nachdem
das Meſsrohr auf den Pfropfen fest aufgesetzt und der Kautschukschlauch D an einer Stelle mit der Hand zusammengedrückt ist,
durch Neigung der Wanne und des Rohres E die Kalilauge
aus und ersetzt dieselbe durch Wasser; dann hebt man das Meſsrohr vom Gummipfropfen
ab, so daſs sich die Kalilauge in dem Rohre mit dem Wasser der Wanne mischt; ersetzt
man noch einmal auf dieselbe Weise die schon sehr verdünnte Kalilauge durch Wasser,
so genügt dies vollkommen.
Zur Bestimmung der Dampfdichte im
Barometerrohr verwenden Ch. A. Bell und F. L. Teed nach der Zeitschrift
für analytische Chemie, 1882 S. 127 ein 38cm langes cylindrisches Glasgefäſs A (Fig.
13 Taf. 20). Das eine Ende desselben ist geschlossen, das andere geht in
eine 8mm weite und 83cm lange Röhre B über, an welche seitlich die
Röhren C und D
angeschmolzen sind. C ist oben zugeschmolzen und mit
Millimetereintheilung versehen, deren Nullpunkt in gleicher Höhe mit der auf B angebrachten Marke m
liegt. Die oberen Theile des Apparates sind mit Glascylinder E umgeben, welcher dazu dient, durch bei a
zu- und bei b wieder abgeleiteten Dampf diesen Theil
des Apparates zu erhitzen. Man bestimmt das Volumen von A bis zur Marke m und berechnet daraus unter
Berücksichtigung der Ausdehnung des Glases das Gewicht dieses Volumens Wasserstoff oder Luft bei 100°
und 100mm Quecksilber von 100°; diese Gröſse nennt
man die Constante des Apparates.
Zur Ausführung eines Versuches dreht man den ganzen Apparat um,
nimmt den Stopfen s ab und füllt nun durch B den ganzen Apparat mit Quecksilber, wobei man Sorge
trägt, daſs möglichst alle Luft aus A und C entfernt wird. Dann bringt man die Substanz in einem
kleinen zugeschmolzenen Glasröhrchen auf die Oberfläche des Quecksilbers in B, setzt bei geöffnetem Hahn h den Stopfen s auf, schlieſst dann den Hahn
und dreht den Apparat um, wobei das Gefäſschen mit der Substanz nach A gelangt. Jetzt öffnet man den Hahn h und läſst so viel Quecksilber auslaufen, daſs A und C mit einander in
Verbindung stehen. Dadurch wird bewirkt, daſs, wenn etwa ein Rest von Luft in einem
dieser beiden Theile zurückgeblieben sein sollte diese Luft jetzt gleichmäſsig auf
A und C vertheilt
wird. Dann bringt man die Mündung von D unter
Quecksilber und läſst durch Schiefhalten des ganzen Apparates so viel Quecksilber
eintreten, daſs A etwa zu ⅙ damit angefüllt ist,
schlieſst h, stellt den Apparat senkrecht und läſst
Dampf in den von E umschlossenen Raum treten. Wenn dann
durch die Hitze das die Substanz enthaltende Gefäſschen gesprengt und der ganze
obere Theil des Apparates gleichmäſsig erhitzt ist, öffnet man den Hahn h und läſst so lange Quecksilber auslaufen, bis es eben
an m steht. Man braucht jetzt nur die Höhe der
Quecksilbersäule in C über m zu messen, um den Druck des Gases in A,
ausgedrückt in Quecksilber von 100°, zu erfahren. Multiplicirt man diesen Druck mit
der Constanten des Apparates und dividirt mit diesem Product in das Gewicht der
angewendeten Substanz, so erhält man die auf Wasserstoff bezieh. Luft bezogene
Dampfdichte.
Das Dampfmanometer von L. Perrier in Paris (* D. R. P. Kl. 42 Nr. 13221 vom
21. August 1880) soll zur Angabe des Alkoholgehaltes der in einem
Destillationskessel enthaltenen Dämpfe oder zur Bestimmung des Concentrationsgrades
von Syrup und ähnlichen Flüssigkeiten dienen. Der Kolben A (Fig. 14
Taf. 20), welcher durch ein in das Kühlgefäſs R
tauchendes Rohr B mit der Luft in Verbindung steht,
wird durch eine Lampe L mit Spiritusbehälter S erwärmt. Der Tubus n im
Mittelpunkt der Lampe trägt den ganzen Apparat. Der mit der zu prüfenden Flüssigkeit
versehene Kolben A ist durch einen Stopfen geschlossen,
durch welchen das Manometer geht, bestehend aus einer an beiden Enden offenen, unten
in eine Spitze auslaufenden Röhre, welche in einen angeschmolzenen Kolben taucht.
Dieser ist bis e mit Quecksilber gefüllt; darüber
befindet sich die Flüssigkeit, aus deren Spannung die der zu prüfenden Flüssigkeit
berechnet werden soll. Ist alles vorgerichtet, so zündet man die Lampe L an und regelt die Wärmeübertragung auf den Kolben A mittels des Trichters c.
Die Dämpfe der siedenden Flüssigkeit verdichten sich im Kühler B. Das Kühlgefäſs R
enthält ein Rohr o, welches durch einen Schlauch mit
dem Rohr H verbunden ist. Dieses ist anfangs nach oben
gerichtet, wird aber horizontal gelegt, wenn der Versuch im Gange ist und die
Quecksilbersäule annähernd zur Ruhe gekommen ist. Das Kühlwasser flieſst nun aus und
der Kolben des Manometers nimmt die Temperatur der ihn umgebenden Dämpfe an. Aus dem
Stande der Quecksilbersäule im Manometer kann man dann den Alkoholgehalt der zu
prüfenden Flüssigkeit berechnen.
Bei dem Löthrohr mit ununterbrochenem
Luftstrahl von A. Koppe in Berlin (* D. R. P.
Kl. 12 Nr. 15369 vom 16. October 1880) füllt die von a
(Fig. 15 Taf. 20) aus eingeblasene Luft, da sie durch die kleine Oeffnung
in der Düse nicht schnell genug entweichen kann, den Gummiballon c, dessen übermäſsige Aufblähung durch die Metallhülle
f verhindert wird. Sobald nun der Arbeiter beim
Athemschöpfen das Blasen unterbricht, schlieſst die im Ballon enthaltene gepreſste
Luft das Ventil b und flieſst nach der Düse ab, aus
welcher sich daher ein ununterbrochener Luftstrom ergieſst.
Tafeln