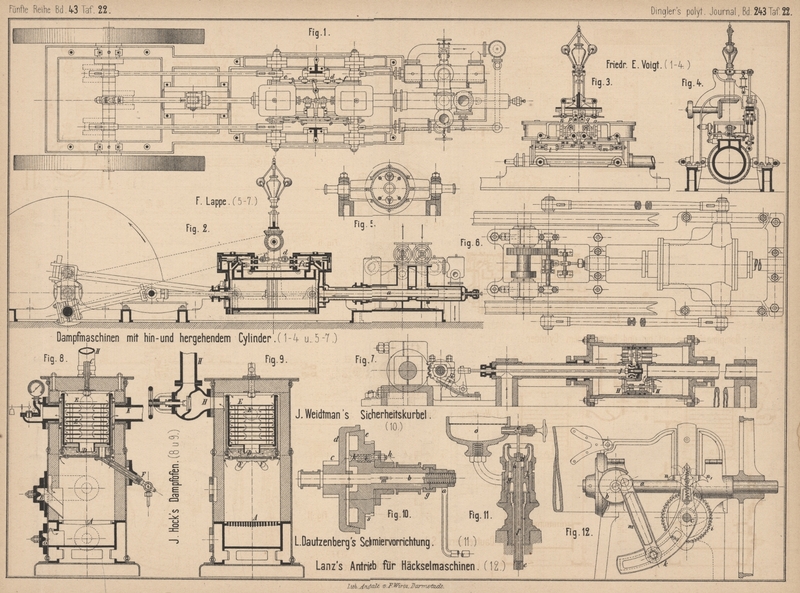| Titel: | Dampfofen von Julius Hock in Wien. |
| Autor: | Whg. |
| Fundstelle: | Band 243, Jahrgang 1882, S. 270 |
| Download: | XML |
Dampfofen von Julius Hock in
Wien.
Mit Abbildungen auf Tafel 22.
J. Hock's Dampfofen.
Bei der in D. p. J. 1881 240 * 2 beschriebenen Anordnung
eines Dampferzeugers mit geschlossener Feuerung hat J.
Hock in Wien einen gewöhnlichen Dampfkessel benutzt und in denselben die
von einem besonderen Ofen kommenden Heizgase durch ein Rohr eingeführt. Bei der vorliegenden neueren
Construction (* D. R. P. Kl. 13 Zusatz Nr. 16104 vom 17. April 1881) sind Ofen und
Dampferzeuger mit einander vereinigt. In einem gemauerten cylindrischen Schachte
befindet sich unten der Rost A (Fig. 8 und
9 Taf. 22), oben der Verdampfer D. Letzterer
besteht aus zwei concentrischen Cylindern und einer Anzahl über einander
aufgestellter Scheiben E. Oben sind beide Cylinder
offen und mit einander verbunden, unten sind beide durch Böden verschlossen; doch
befindet sich im Boden des inneren Cylinders eine centrale Oeffnung, von welcher ein
kleiner Stutzen herabhängt. Das zu verdampfende Wasser wird durch das Rohr C zugeleitet und flieſst dann auf den Platten, wie
durch die Pfeile angedeutet, allmählich nieder. Die Heizgase werden bei der
Inbetriebsetzung zunächst durch einen Schornstein H
abgeleitet. Sobald der Ofen genügend erwärmt ist und mit der Dampfabgabe begonnen
werden soll, wird das Ventil in H gleichwie die
Feuerthür B und die Aschenfallthür G luftdicht verschlossen und mittels eines Gebläses
sowohl unterhalb, wie oberhalb des Rostes gepreſste Luft eingeführt. Die Feuergase
sind dann gezwungen, oben in den inneren Cylinder des Verdampfers einzutreten und
zwischen den Platten E hindurch in gleicher Richtung
mit dem niederrieselnden Wasser abwärts zu strömen, dabei das letztere in Dampf
verwandelnd. Dampf und Gase gelangen darauf durch das unten in D befindliche Wasser hindurch in den Zwischenraum
zwischen den beiden Verdampfcylindern und strömen aus diesem durch das Rohr K ab. Dadurch, daſs die Gase durch das Wasser ziehen
müssen, werden sie von der mitgerissenen Flugasche u. dgl. befreit; allerdings wird
der Verdampfer deshalb einer sehr häufigen Reinigung bedürfen. Um den Wasserstand in
D wenigstens ungefähr erkennen zu können, sind vom
Boden des äuſseren Cylinders aus zwei Röhren F nach
auſsen geführt und auf die eine derselben ist ein kurzer Stutzen aufgesetzt. Dem
Abzugsrohre K gegenüber ist ein Stutzen zur Aufnahme
des Manometers und des Sicherheitsventiles angebracht.
Hinsichtlich der Verdampfungsweise gehört nach Obigem dieser Dampfofen zu den in
England mehr als in Deutschland bekannten Einspritzkesseln (injection-boilers, vgl. J. Robertson, 1870
198 * 105), welche einer äuſserst sorgfältigen Wartung bedürfen. Da nur eine sehr
geringe Wassermenge im Kessel enthalten ist, so muſs sowohl die Zuführung des
Speisewassers, wie auch die der zur Verbrennung nöthigen Luft genau nach dem
Dampfverbrauch geregelt werden, wenn nicht die Spannung stark schwanken soll. Die
Regulirung der Speisung wird aber einige Schwierigkeiten machen, da man den
Wasserstand in D nicht gut beobachten kann.
Whg.
Tafeln