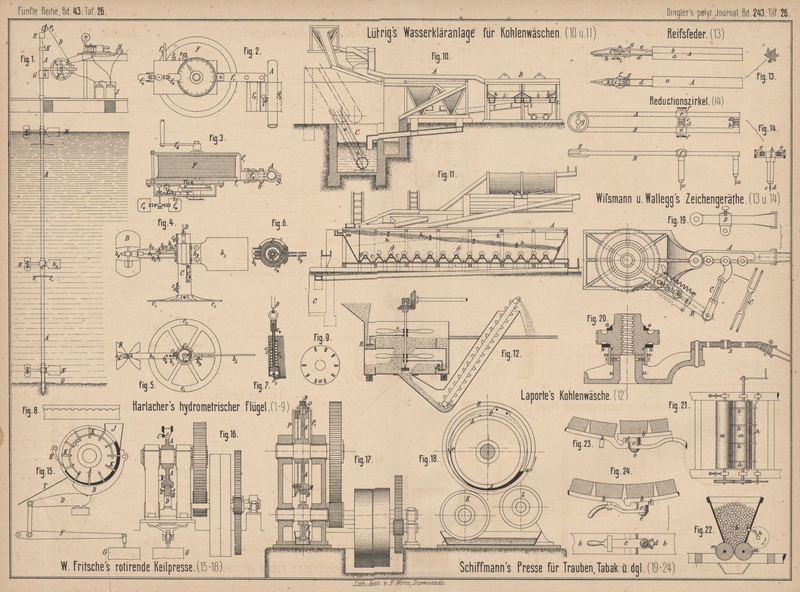| Titel: | C. Lührig's Wasserkläranlage für Kohlenwäschen. |
| Autor: | S–l. |
| Fundstelle: | Band 243, Jahrgang 1882, S. 307 |
| Download: | XML |
C. Lührig's Wasserkläranlage für
Kohlenwäschen.
Mit Abbildungen auf Tafel 26.
Lührig's Wasserkläranlage für Kohlenwäschen.
Um thunlichst allen denjenigen Uebeln entgegen zu arbeiten, welche damit verbunden
sind, daſs die aus den Kohlenwäschen abflieſsenden Wasser trotz des meist
erfolgenden Durchganges durch eine Anzahl von Klärsümpfen doch nicht unbeträchtliche
Mengen sehr feiner Kohlen- und Bergetheilchen mit sich führen, hat C. Lührig in Dresden (* D. R. P. Kl. 1 Nr. 13999 vom 3. October
1880) eine Wasserkläranlage in Vorschlag gebracht, bei welcher Faschinen von
Birkenreisig die wesentlichste Rolle spielen. Etwas verschieden ist die Behandlung
der Kohlen führenden Wasser von der der Bergetrübe mit Rücksicht auf die mindestens
an vielen Orten noch mögliche Verwerthung von Kohlenschlämmen zur Kokerei und
Feuerung.
Die aus den Setzmaschinen abflieſsende Kohlentrübe wird zunächst in einen gröſseren,
mit Birkenreisig überdeckten Sumpf geführt, aus Welchem der Abfluſs über der
Reisigdecke liegt, so daſs die Trübe durch letztere hindurch aufsteigen und dabei
den gröſsten Theil der mitgeführten feinen Kohle absetzen muſs. Aus dem
Abfluſsgerinne treten nun die noch weiter zu klärenden Wasser in ein aus zwei neben
einander liegenden Abtheilungen A (Fig. 10 und
11 Taf. 26) bestehendes Spitzkastensystem, in dessen Hälften je eine
Schicht Birkenreisig h in flacher, einander
entgegengesetzter Neigung fest liegt. Unterhalb der Faschinendecken der ersten
Abtheilung tritt bei m die Trübe ein, nimmt ihren Weg
durch das Reisig hindurch in die zweite Abtheilung, in welcher sie wiederum unter
dem Reisig eintritt und verlaſst durch dieses den Apparat geklärt. Im unteren Theile
der Spitzkästen sind eine Anzahl kleiner, trichterförmiger Scheidungen c angebracht, oben mit gelochten Spitzen versehen und
mit halbkreisförmigen, gelochten Blechkappen d
überdeckt. Unter den Spitzen liegen kleine, als Sickerkanäle dienende Rinnen und die
Trichtermündungen selbst sind mit Schieberverschluſs g
versehen, welcher den Austritt der concentrirten Massen regelt. Letzteren wird durch
die Blechkappen möglichst viel Wasser entzogen und gehen sie dann in einen gröſseren
Sumpf C bis zu erfolgender weiterer Verwerthung.
Auch die Bergetrübe flieſst durch einen mit Reisig überdeckten Sumpf hindurch in das
Sumpfkastensystem B mit zwei Reihen zu je 7
Abtheilungen, die durch verticale Wände von ⅓ der Höhe der Umfassungen von einander
getrennt sind. Jede Abtheilung besitzt in der Mitte ihres horizontalen Bodens eine
rechteckige, durch Schieber i geschlossene Oeffnung,
aus welcher, sobald der Schlamm sich in einer der beiden Reihen angehäuft hat und
nachdem die Trübe in die andere Reihe geschlagen worden ist, der Schlamm in
untergeschobene Wagen abgelassen wird. An den Längswänden der Abtheilungen liegen
flach ansteigende Siebbleche k mit darunter
befindlichen Abfluſsrinnen l, durch welche das aus den
niedergeschlagenen Schlämmen sich noch ausscheidende Wasser abflieſst.
S–l.
Tafeln