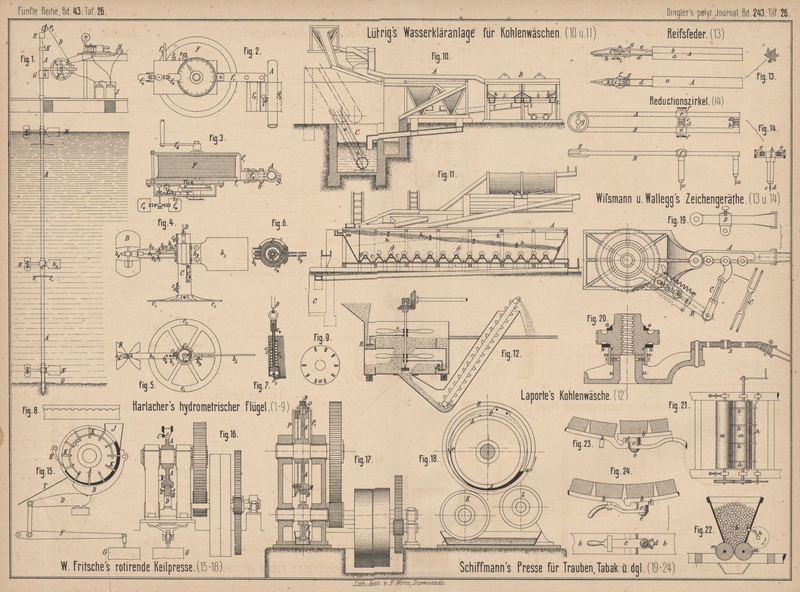| Titel: | Wissmann und Wallegg's Reissfeder und Reductionszirkel. |
| Autor: | A. Zz. |
| Fundstelle: | Band 243, Jahrgang 1882, S. 309 |
| Download: | XML |
Wiſsmann und Wallegg's Reiſsfeder und Reductionszirkel.
Mit Abbildungen auf Tafel 26.
Wiſsmann und Wallegg's Reiſsfeder und Reductionszirkel.
Die Firma Wiſsmann und Wallegg in Wien und Frankfurt a.
M. hat sich in neuerer Zeit durch Herstellung verbesserter Zeicheninstrumente sehr
verdient gemacht und mehrere Patente in dieser Richtung erhoben. Im Anschluſs an den
Bericht S. 205 d. Bd. soll im Folgenden noch deren Reiſsfeder und Reductionszirkel
Besprechung finden.
Die Reiſsfedern (vgl. * D. R. P. Kl. 42 Nr. 13342 vom
13. December 1879) sind sämmtlich mit einem dreikantigen prismatischen Griffe und
mit einem zwischen den Federschenkeln liegenden Sperrrädchen zur Einstellung der
Strichstärke versehen. Fig. 13
Taf. 26 zeigt eine solche Reiſsfeder mit Punktirstift zur Ausführung von
Punktirungen.
Der Griff A aus Elfenbein hat als Querschnitt ein
gleichseitiges Dreieck und gestattet ein sehr bequemes Festhalten der Reiſsfeder in
gewünschter Stellung; man legt dabei den Daumen auf die Seitenfläche a, den Zeigefinger auf b
und den Mittelfinger auf c. Zur Einstellung der
Strichstärke dient eine kleine Schraube, welche in dem einen Federschenkel d durch einen kleinen Stift gehalten wird, während
durch die Drehung einer als Sperrrädchen ausgebildeten Mutter f der andere Federschenkel e in gröſseren oder geringeren Abstand zum Schenkel d gebracht werden kann. Zum Festhalten des
Sperrrädchens in einmal eingestellter Lage dient ein kleiner Sperrkegel g, welcher durch eine schwache, auf seinem Rücken
liegende Feder nur so stark in die Zähne des Rädchens f
eingreift, daſs dieses in jeder Richtung und auch während des Ziehens einer Linie
mit dem Ringfinger der die Feder haltenden Hand in Drehung versetzt werden kann,
wodurch eine Aenderung der Strichstärke während des Ziehens möglich wird. Die
Ausführung gleichmäſsig variirender Strichstärke erfordert jedoch bedeutende Uebung;
besonders schwierig ist, eine gleichmäſsige Zunahme des Striches zu bewirken, weil
dabei der Ringfinger das Sperrrädchen in der Richtung nach der Spitze der Reiſsfeder
zu umdrehen muſs, was für die Hand unbequem ist. Zur Benutzung bei Punktirungen
dient das durch die Stellschraube i einstellbare,
seitlich liegende Plättchen h, welches mit einem
Schlitze auf einem kleinen, in dem Federschenkel d
eingeschraubten Stifte läuft, am unteren Ende aber in eine stumpfe Spitze übergeht,
welche beim Gebrauch über den Erhabenheiten und Vertiefungen von Punktirlinealen
herstreicht und dadurch ein abwechselndes Ziehen der Feder oder Abheben derselben
vom Papier bewirkt.
Der Reductionszirkel ist aus dem Bestreben
hervorgegangen, den Zirkelspitzen eine solche Lage zu geben, daſs dieselben beim
Abgreifen und Abstechen
in normaler Richtung auf die Papierfläche zu stehen kommen. Fig. 14
Taf. 26 zeigt den Zirkel in ⅓ n. Gr. Am Ende jedes der beiden um Gelenk g drehbaren Zirkelschenkel A und B ist senkrecht dazu je eine
Zirkelspitze a und b
eingeschraubt; die Reductionsspitzen c und d sind auf zwei kleinen Schiebern e befestigt und können mit diesen in geschlossener Lage
des Zirkels gemeinschaftlich auf den Zirkelschenkeln verschoben und durch die
Stellschrauben f daran festgestellt werden. Die Spitzen
a, b und c, d liegen
in einer Ebene mit dem Mittelpunkt des Gelenkes g. Auf
dem einen Zirkelschenkel ist eine Theilung angebracht, die alle echten Brüche von 0
bis 1 enthält, auf dem anderen eine Theilung, welche dazu benutzt wird, Kreisumfänge
in eine zwischen 2 und 20 liegende Zahl gleicher Theile einzutheilen.
Behufs Reduction von Längen in bestimmtem Verhältniſs stellt man bei geschlossenem
Zirkel die Reductionsspitzen, welche sich in Folge des Eingriffes des
Schraubenkopfes h des einen Schiebers in die Höhlung
des anderen gemeinschaftlich vorschieben lassen, auf das verlangte
Reductionsverhältniſs ein, nimmt dann die betreffende Länge zwischen die
Zirkelspitzen a, b und hat dann im Abstand der
Reductionsspitzen c, d die reducirte Länge. Will man
die Seitenlänge eines n-Eckes wissen, so stellt man die
Reductionsspitzen auf die Zahl n der zweiten Theilung
ein, nimmt den Radius des umschriebenen Kreises in die Zirkelspitzen und findet dann
im Abstand der Reductionsspitzen die gesuchte Seitenlänge. Der Zirkel hat den
Vortheil, daſs man genau damit auftragen kann, weil die Zirkelspitzen immer normal
zum Papier stehen, daſs die ganze Schenkellänge des Zirkels zur Anbringung der
Theilung verfügbar ist und daſs die Theilung auch noch richtig ist, wenn durch
Abbrechen oder Nachschleifen der Zirkelspitzen die Länge derselben sich verändert
hat. Allerdings muſs der Zirkel, der übrigens sehr bequem zu öffnen ist, in einer
etwas ungewohnten Lage benutzt werden und muſs man sich bei genauer Arbeit beider
Hände bedienen.
Eine Benutzung des Zirkels mit abgeschraubten Reductionsspitzen als gewöhnlicher
Stechzirkel und in gestreckter Lage der Schenkel als Stangenzirkel, wie es von den
Fabrikanten empfohlen wird, scheint uns nicht zweckmäſsig. Das Abschrauben der
Reductionsspitzen ist unbequem und in Folge entstehender Abnutzung des Gewindes
Grund zu fehlerhafter Stellung der Spitzen; einer Verwendung als Stangenzirkel steht
der Umstand entgegen, daſs die Drehbarkeit um Gelenk g
bei gestreckter Lage der Zirkelschenkel nicht aufgehoben werden kann, wodurch sich
der Zirkel leicht beim Abstechen verstellt.
Wiſsmann und Wallegg's Stechzirkel mit verticaler Spitzenführung beruht auf gleichem Principe wie
der Zirkel von H. Schmidt in Berlin (1879 234 * 448), nur mit dem
Unterschiede, daſs hier eine dünne Stange, welche durch rechtwinklig zu den unteren
Zirkelschenkeln gebohrte Löcher geht, die Parallelführung der Zirkelspitzen bewirkt
und die feine Einstellung durch eine federnde Spitze am einen Schenkelende
ausgeführt wird. Der Zirkel ist übrigens handlich und sehr brauchbar.
A. Zz.
Tafeln