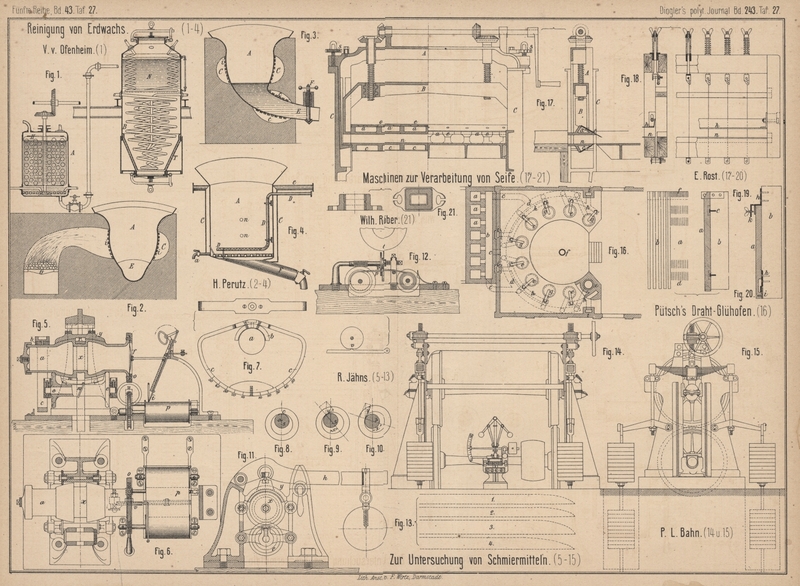| Titel: | Albert Pütsch's Draht-Glühofen für Gasbetrieb. |
| Fundstelle: | Band 243, Jahrgang 1882, S. 318 |
| Download: | XML |
Albert Pütsch's Draht-Glühofen für
Gasbetrieb.
Mit einer Abbildung auf Tafel 27.
Pütsch's Draht-Glühofen für Gasbetrieb.
Wenn schon die Gasfeuerung für Glühzwecke im Allgemeinen verhältniſsmäſsig wenig
Eingang gefunden hat, so ist besonders in der Drahtfabrikation das Glühen mit Gas bis jetzt in ausgedehnterem Maſsstabe
noch nicht durchgeführt worden und dürften somit einige Mittheilungen, welche Albert Pütsch in Berlin in Glaser's Annalen, 1882 S. 8 über eine von ihm ausgeführte gröſsere
Anlage veröffentlicht, von gewissem Interesse sein. Die Anlage, welche auf dem Werk
von Heinr. Kern und Comp. in Gleiwitz in Oberschlesien
im Betrieb ist, dient zum Glühen von Eisendraht und besteht aus 10 Glühöfen, welche
ihr Gas aus einer Batterie von 7 Generatoren erhalten. Das Brennmaterial ist
Kleinkohle.
Wie aus dem Anlageplan in Fig. 16
Taf. 27 ersichtlich, sind die Generatoren a auſserhalb
des Glühraumes auf dem Hofe angelegt. Die gebildeten Gase treten zunächst in den groſsen
gemeinschaftlichen Sammelkanal b und werden durch die
Seitenkanäle c dem Ringkanal d zugeführt, von welchem sie in die eigentlichen Glühöfen e gelangen. Die Glühöfen, 10 an der Zahl, sind in einem
Kreise aufgestellt, in dessen Mittelpunkt sich ein Drehkrahn f befindet, mit welchem die verschiedenen Arbeiten an den Oefen, Ein- und
Ausheben der Töpfe, Abheben der Deckel u. dgl., vorgenommen werden. Die Oefen haben
cylindrischen Querschnitt (vgl. Schnitt bei x). Die
Gase treten unten in aus der Zeichnung nicht ersichtliche Brenner, woselbst die
Vereinigung mit atmosphärischer Luft erfolgt. Die gebildeten Flammen umspülen die
Glühtöpfe und verlassen den Ofen oben durch ein im Deckel angebrachtes eisernes Rohr
g, um in den Schornsteinkanal h zu gelangen. (Oertliche Verhältnisse haben die
Benutzung von 4 vorhandenen kleineren Schornsteinen verlangt, so daſs also, wie aus
der Zeichnung zu entnehmen, die 10 Oefen in 4 Gruppen, zwei zu je 3 Oefen und zwei
zu je 2 derselben, getheilt sind, welche jede mit einem Schornstein i in Verbindung gesetzt ist.)
Zur Regulirung des Gases, der Luft sowie des Schornsteinzuges sind selbstredend
besondere Vorrichtungen vorhanden. Sämmtliche Deckel, sowie die Verbindungen
derselben mit den Schornsteinkanälen sind zur leichteren Beweglichkeit in
Sandverschlüssen gedichtet.
Die Bedienung der Oefen selbst hat sich als eine sehr bequeme herausgestellt; ebenso
sind die Betriebsresultate günstig zu nennen: Geglüht wurden in 12 Stunden 20 Töpfe,
von welchen jeder durchschnittlich mit 1250k
Eisendraht besetzt war, so daſs die Production während der genannten Zeit 25000k geglühte Drahtwaare betrug. Zum Glühen selbst
wurden in sämmtlichen 7 Generatoren 2730k
Steinkohlen verwendet; es wurden also 100k Draht
mit 11k Steinkohlen geglüht. Da der Preis der
verfeuerten Kohle sich auf 47 Pf. für 100k stellt,
so kostete das Glühen von 100k Draht 5,1 Pf.
Die Anlage ist seit fast einem Jahre in Betrieb und zeigt bezüglich der Haltbarkeit
der Glühtöpfe sehr günstige Resultate, welche auf die Abwesenheit einer jeden
Stichflamme zurückzuführen sind. Das System eignet sich für Torf, Holz und
Braunkohle ebenso gut wie für Steinkohlen; es sind alsdann nur die Generatoren dem
Brennmaterial entsprechend zu construiren. Da die Generatoren in den meisten Fällen
stets auſserhalb des Glühraumes auf dem Fabrikhofe Platz finden werden, so ist eine
Umänderung einer bestehenden, mit directer Feuerung versehenen Anlage auf Gasbetrieb
ziemlich einfach um so mehr, als durch Beseitigung des Rostes und des Aschenfalles
vorhandener Oefen genügend Raum gewonnen wird, um den Gasbrenner anzubringen.
Tafeln