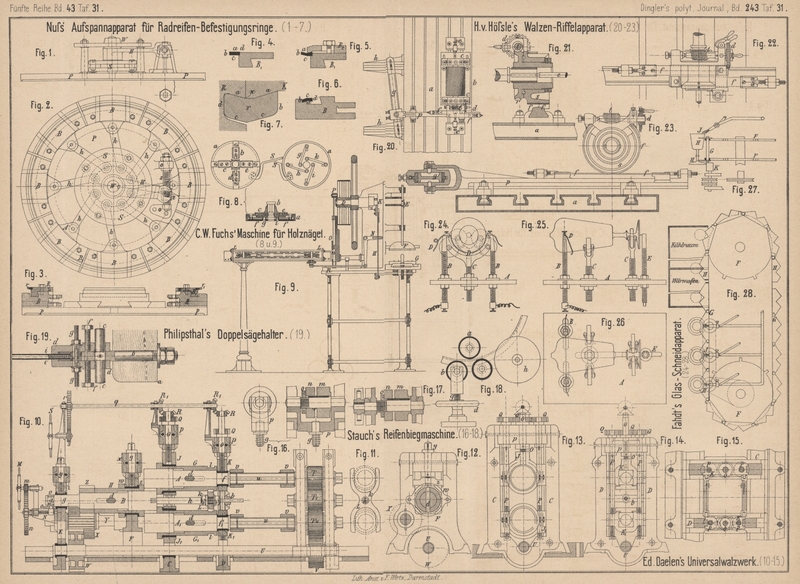| Titel: | J. Fahdt's Verfahren zum Schneiden von Glaswaaren und zum Verschmelzen von Schnittflächen. |
| Fundstelle: | Band 243, Jahrgang 1882, S. 375 |
| Download: | XML |
J. Fahdt's Verfahren zum Schneiden von Glaswaaren und zum
Verschmelzen von Schnittflächen.
Mit Abbildungen auf Tafel 31.
Fahdt's Schneid- und Verschmelzapparat für Glas.
Das Schneiden von Glaswaaren führt J. Fahdt in Dresden
(* D. R. P. Kl. 32 Nr. 14181 vom 29. Juli 1880) mittels Drähten aus, welche durch
Elektricität zum Glühen gebracht werden. Die hierzu erforderliche Vorrichtung ist in
den Fig. 24 bis 26 Taf. 31
abgebildet. Auf einer Platte A lassen sich die mit den
Polen einer Batterie leitend verbundenen Metallschrauben B in Querschlitzen verschieben und feststellen, so daſs der in ihnen
festgeklemmte Draht D sich an der beabsichtigten
Schnittstelle dem Umfang eines Glaskörpers anschmiegen kann, welcher auf den in den
gegabelten Ständern C gelagerten Stützrollen ruht und
durch eine Gegenspitze an der Stütze E gegen eine
Verschiebung nach rückwärts gesichert ist. Diese Stütze sowie die Ständer C sind in einem Längsschlitz der Platte A Dach Bedürfniſs verschiebbar. Das Schlieſsen des
Stromes bewirkt das Erglühen des Drahtes D, wodurch
dessen Berührungsstelle mit dem von Hand in Drehung versetzten Glaskörper
augenblicklich so stark erwärmt wird, daſs derselbe durch eine plötzliche Kühlung
oder auch nur durch Berührung mit einem feuchten Gegenstande einen feinen Sprung an
der erhitzten Linie erhält und sich da glatt abtrennt.
Um nun der Schnittfläche die scharfen Kanten zu nehmen, werden dieselben auf dem in
Fig. 27 und 28
dargestellten Apparat verschmolzen. Die Gläser werden auf Lager H gelegt, welche an der endlosen, über die Scheiben F gelegten Kette G
befestigt sind. Diese Kette wird durch eine geeignete Vorrichtung in ruckweise
Bewegung versetzt. Nach jedem Vorschub der Kette kommen die Gläser mit ihrer
Schnittfläche vor je eine Stichflamme J, welche einem
Löthrohr oder einer Glasbläserlampe entströmt. Hierbei werden sie von einer Flamme
vorgewärmt, von den nächsten an den Schnittkanten verschmolzen. Um alle Stellen der
Schnittfläche vor die Flammen zu bringen, erhalten die Gläser zugleich eine drehende
Bewegung mit Hilfe von Reibungsrollen K (Fig.
27), auf welchen sie mit ihren Füſsen aufliegen. Sind die Gläser an den
Rändern völlig abgerundet, so werden sie mittels der Kette G zunächst in einen Wärmofen geführt, um durch gleichmäſsige Erwärmung das
Abspringen der verschmolzenen Theile zu hindern. Von da aus gelangen sie noch in
einen Kühlraum, nach dessen Verlassen sie zum Verpacken fertig sind. Damit beim
Verschmelzen der verschiedenen Schmelzbarkeit des Glases Rechnung getragen werden
kann, müssen die Flammen leicht regulirbar sein.
Tafeln