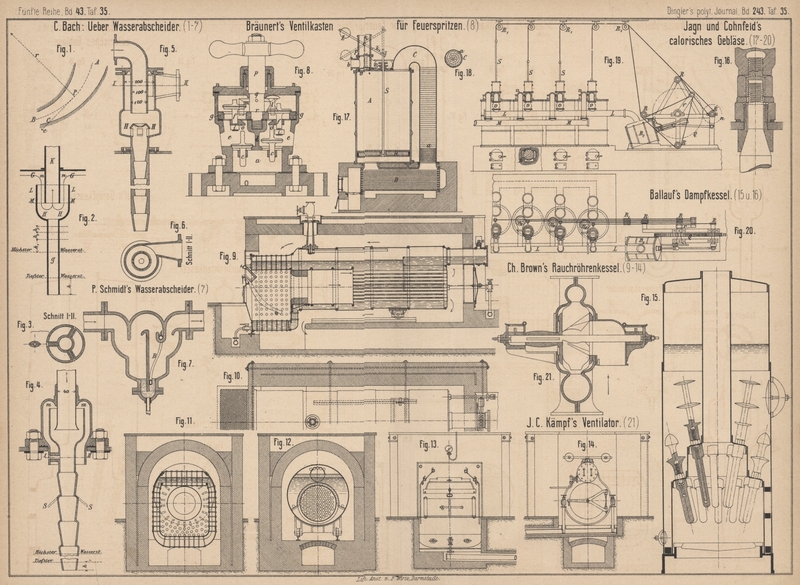| Titel: | Ch. Brown's Rauchröhrenkessel. |
| Autor: | Whg. |
| Fundstelle: | Band 243, Jahrgang 1882, S. 447 |
| Download: | XML |
Ch. Brown's Rauchröhrenkessel.
Mit Abbildungen auf Tafel 35.
Ch. Brown's Rauchröhrenkessel.
Der von Ch. Brown in Winterthur entworfene, in Fig.
9 bis 14 Taf. 35
nach Engineering, 1881 Bd. 32 S. 255 abgebildete
Rauchröhrenkessel hat einige Aehnlichkeit mit einem Locomotivkessel, in so fern er
im Wesentlichen aus einem cylindrischen, von Rauchröhren durchzogenen Langkessel und einer viereckigen
Feuerbüchse besieht. Die letztere aber unterscheidet sich von gewöhnlichen
Feuerbüchsen zunächst dadurch, daſs sie statt des Wasserraumes an der Vorderseite
einen solchen an der Unterseite hat und daſs auch die äuſsere Wand oben durch eine
ebene Platte abgeschlossen ist. Die Verankerung der äuſseren mit der inneren Kiste
durch eingeschraubte Stehbolzen ist die gebräuchliche. Seitenwand, Decke und
Hinterwand der inneren Kiste sind mittels nach auſsen gerichteter Flanschen
verbunden, so daſs die Nieten vollständig dem Feuer entzogen sind.
Vorn ist die Feuerbüchse durch eine Guſseisenplatte verschlossen, welche die nöthigen
Thüren, Wasserstandszeiger u.s.w. trägt und mit dem Mauerwerk verankert ist. Der
Rost ist stark geneigt, und zwar ist bemerkenswerth, daſs die Roststäbe oben nicht
gerade, sondern nach einer Kettenlinie ausgeschweift sind. Hierdurch soll bewirkt
werden, daſs der Druck zwischen den von unten nach oben auf einander folgenden
Kohlenschichten überall gleich groſs sei und in Folge dessen das Nachrutschen
derselben gleichmäſsig und nicht ruckweise stattfinde. Es ist dies eine Erfindung
von Fr. Pasquay in Wasselnheim (Unterelsaſs), welche
sich gut bewähren soll. Die Roststäbe sind oben an einen Träger aus Winkeleisen
angehängt und ruhen unten lose auf einem runden Querstab, so daſs die Ausdehnung
nicht behindert ist. Der Raum zwischen dem unteren Ende des Rostes und der hinteren
Feuerbüchswand wird immer mit Asche und Schlacken angefüllt erhalten. Oberhalb der
Einfüllöffnung sind besondere Luftkanäle mit Schiebern angeordnet.
An die Feuerbüchse schlieſst sich zunächst eine Verbrennungskammer, aus mehreren
Ringen gebildet, die gleichfalls mit auſsen liegenden Flanschringen vernietet sind.
Der vordere Theil dieser Kammer ist mit einem dicken Ring feuerfester Steine
ausgefüttert, durch welchen eine innige Mischung der Verbrennungsgase und der Luft
wie auch ein Schutz der betreffenden Wandung erzielt wird. Die Heizgase strömen dann
aus der Verbrennungskammer durch 83 Röhren von 70mm innerem Durchmesser und 3mm
Wandstärke nach der Rauchkammer, welche zwischen der hinteren Rohrwand und dem
Mauerwerk gelassen ist, um darauf, nach vorn zurückkehrend, den Kessel allseitig von
auſsen zu umspülen und schlieſslich durch den Fuchs unten abzuziehen.
An dem hinteren Ende des Kessels ist in Wasserstandshöhe ein durch das Mauerwerk
reichender Stutzen angebracht, der mit einem Mannlochdeckel verschlossen ist und
oben die Sicherheitsventile trägt. An seiner unteren Fläche tritt das Speisewasser
ein, welches dann aus dem Stutzen zunächst in einen sattelförmigen Schlammsammler
und aus diesem durch Ueberfall über die den Schlammsammler vorn begrenzende
senkrechte Wand in den Kessel gelangt. Die Niederschläge können durch zwei Abblaseröhren,
welche von den tiefsten Punkten des Schlammsammlers ausgehen, beliebig (etwa jeden
Morgen) entfernt werden. In der Schweizer Locomotiv- und
Maschinenfabrik zu Winterthur ist ein Kessel mit einem derartig
angeordneten Schlammsammler seit Anfang 1877 im Betriebe und Brown versichert, daſs die Innenseiten des Kessels noch schwarz sind.
Der Dampf wird von fünf engen, oben geschlitzten Sammelröhren aufgenommen, welche in
einen guſseisernen Kasten münden. Für das von diesem ausgehende Dampfleitungsrohr
ist in dem Kesselgewölbe eine Oeffnung gelassen, die groſs genug ist, um die
Anschluſsflansche durchzulassen. Dieselbe wird oben durch eine Platte abgeschlossen,
welche gegen das Dampfrohr abgedichtet ist und deren nach unten umgebördelter Rand
in Sand eintaucht. Durch diese Anordnung wird ein Entweichen der Heizgase verhütet,
ohne die. freie Bewegung des Rohres bei der Ausdehnung des Kessels zu hindern. Um
die letztere in vollstem Maſse zu gestatten, ist der Kessel nur am vorderen Ende
befestigt und ruht hinten auf einem Guſseisenträger, der mit zwei auf Schienen
laufenden Rollen versehen ist.
Die Feuerbüchse ist aus Stahl gefertigt, während für den Langkessel Schmiedeisen
verwendet worden ist. Der Kessel ist für eine Spannung von 8at berechnet, wird aber nur mit 5at,5 betrieben. Die Gesammtheizfläche beträgt
70qm, die Rostfläche 1qm,5, der Verbrauch an guten Saarbrücker Kohlen
150k in der Stunde, wobei mit 1k Kohle 9k,3
Wasser verdampft werden sollen.
Whg.
Tafeln