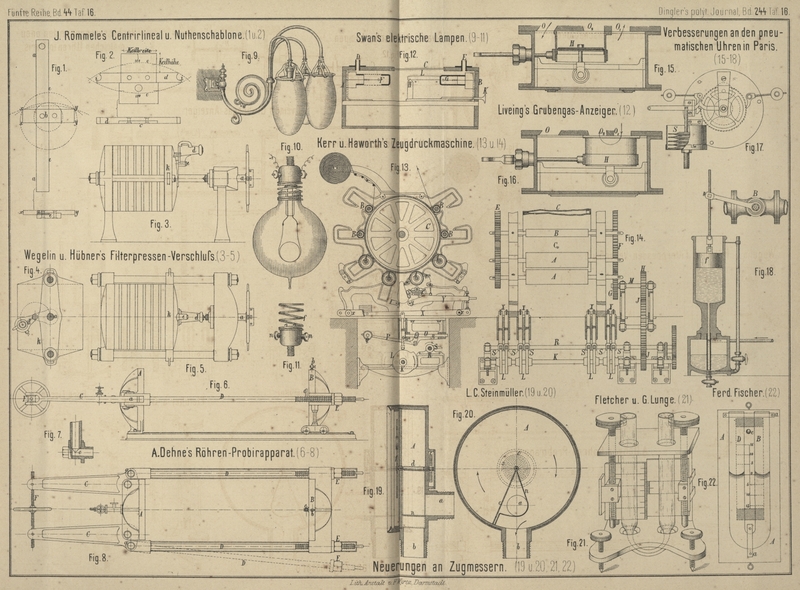| Titel: | Die pneumatischen Uhren in Paris. |
| Fundstelle: | Band 244, Jahrgang 1882, S. 200 |
| Download: | XML |
Die pneumatischen Uhren in Paris.
Mit Abbildungen auf Tafel 16.
Die pneumatischen Uhren in Paris.
Nach H. Peligot's neuestem Berichte im Bulletin de la Société d'Encouragement, 1882 Bd. 9 S. 9
über die seit dem 15. März 1880 in Paris eingeführten pneumatischen Uhren nach dem
System Popp und Resch,
Gründer der Société générale des horologes
pneumatiques, beträgt die Länge des unterirdischen Röhrennetzes gegenwärtig
23km und umfaſst 14 öffentliche Kandelaber mit
33 Zifferblättern. Die Zahl der Abonnenten beläuft sich bereits auf 1300 in 500
Häusern, mit ungefähr 2500 Uhren, ein Erfolg, welchen der Berichterstatter der
auſserordentlichen Einfachheit des Systemes, sowie der Regelmäſsigkeit, Genauigkeit
und Sicherheit des Dienstes zuschreibt.
Hinsichtlich der technischen Einrichtung verweisen wir auf die in D. p. J. 1880 237 * 379
veröffentlichte Beschreibung. Die einzigen seit Einführung des pneumatischen
Betriebes der städtischen Uhren in Paris hinzugekommenen Verbesserungen beziehen
sich auf den Dreiwegehahn, welcher in jeder Minute eine gewisse Menge verdichteter
Luft aus dem Betriebscylinder in das Röhrennetz einläſst, und auf den Kolben der
Secundäruhren, welcher die Bestimmung hat, den empfangenen Luftstoſs auf das
Zeigerwerk der letzteren zu übertragen.
Der Dreiwegehahn R (vgl. Bd. 237 Taf. 32 Fig. 6 und
7) ist durch die in Fig. 15 und
16 Taf. 16 dargestellte Schiebersteuerung mit dem Schieber H ersetzt. Die Gleitfläche des Schieberkastens hat drei
Oeffnungen O, O1 und
O2. Die Oeffnung
O, welche von dem Schieber H nie bedeckt wird, vermittelt die Verbindung des Betriebs- oder
Vertheilungscylinders mit dem Schieberkasten. Bei der Stellung Fig. 15
steht die Oeffnung O1
mit der Oeffnung O, d.h. die Straſsenleitung mit dem
Betriebscylinder in Verbindung. Es entweicht daher aus dem letzteren eine gewisse
Menge gepreſster Luft in das Röhrennetz, um die Zeigerwerke der verschiedenen in
dasselbe eingeschalteten Uhren in Bewegung zu setzen. Nach Verfluſs einer gewissen
Secundenzahl rückt der Schieber in die Lage Fig. 16,
wodurch die Verbindung des Betriebscylinders mit der Straſsenleitung aufgehoben,
dagegen die der letzteren mit der äuſseren Atmosphäre mittels der Oeffnung O2 hergestellt
wird.
Die auf den Kolben O (vgl. Bd. 237 Taf. 32 Fig.
8 und 9)
bezügliche Verbesserung ist durch Fig. 17
Taf. 16 veranschaulicht. Die Stelle des früheren Kolbens vertritt eine Art Blasebalg
S, welcher unter dem Einflüsse des nach jeder
Minute auftretenden Luftstoſses sich aufbläht und mit Hilfe eines Hebels und einer
Sperrklinke das Steigrad von 60 Zähnen um einen Zahn weiter bewegt.
Fig.
18 endlich veranschaulicht in einem deutlicheren Verticaldurchschnitte den
in Bd. 237 S. 380 bereits beschriebenen und dort auf Taf. 32 in Fig. 5 nur
in allgemeinen Umrissen skizzirten Nachfüll- oder Speiseapparat mit seinem auf dem
Quecksilber ruhenden Schwimmer f und dem Durchlaſshahn
B.
Tafeln